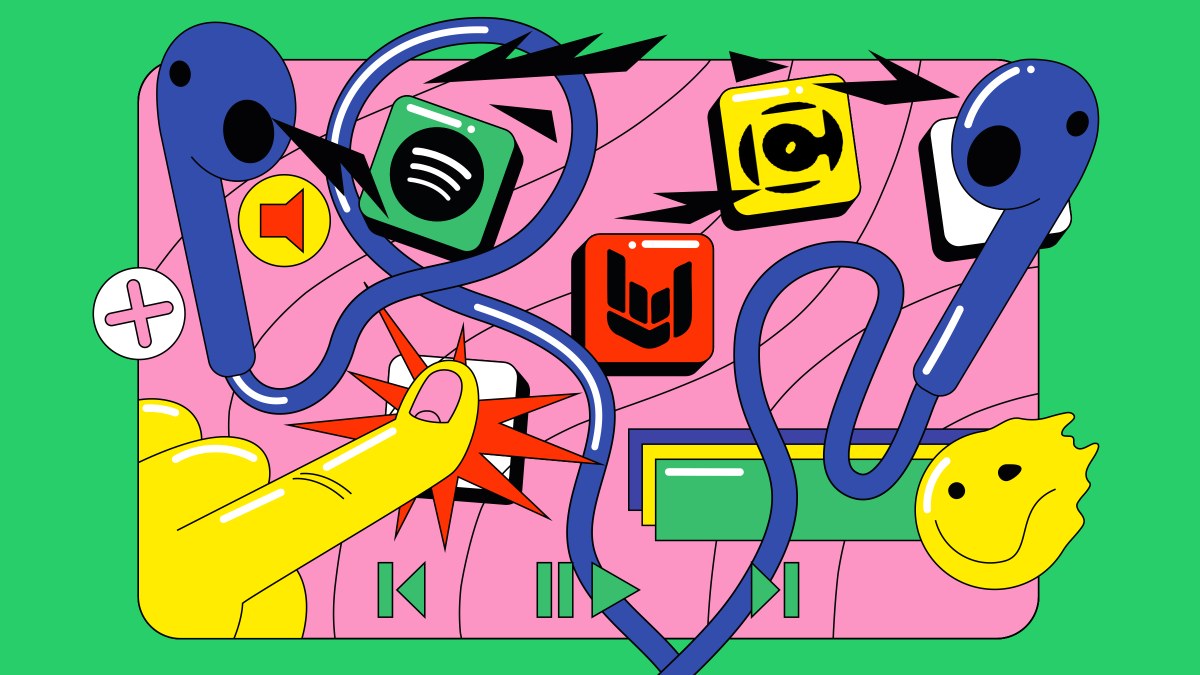Die immer stärker werdende Kritik am Musikstreaming-Giganten Spotify, öffnet Räume für Alternativen. Immer mehr kleine Plattformen wollen dem Marktführer die Stirn bieten. Wie soll das funktionieren?
Der Fokus liegt auf dem bewussten Hören und einer kleineren Zielgruppe
Illustration: der Freitag
Streamingplattformen für Musik funktionieren anders als die für Film und Fernsehen. Netflix, MUBI und Co. lizenzieren ihre Inhalte direkt und bieten nur eine Auswahl dessen an, was eigentlich erhältlich ist. Musikplattformen hingegen werden von Digitalvertrieben mit mehr oder minder allem beliefert, was weltweit hochgeladen wird.
Im Grunde bieten alle also dieselben Inhalte. Für das Publikum hat das Vorteile: Niemand muss doppelt Abos abschließen, ein Wechsel zwischen den Plattformen ist recht unkompliziert. Was heißt, dass das Produkt den Unterschied machen muss. Spotify konnte sich dank ausgeklügelter Empfehlungslogiken als Marktführer etablieren, Apple Music setzt hingegen auf Personality-getriebene Radiostationen.
Mittels solcher Alleinstellungsmerkmale wollen große Plattformen ihr Wachstum antreiben. Allerdings versuchen zunehmend mehr Dienste, sich gar nicht als All-you-can-hear-Buffets dem größtmöglichen Publikum anzubieten. Qobuz, Rokk und Cantilever möchten bewussteren Musikkonsum fördern – und dabei Acts besser zahlen. Als Cantilever am 14. Januar in Deutschland startete, bot er auf den ersten Blick herzlich wenig – ein einziges Album, um genau zu sein: Crooked Wing von der Drama-Pop-Band These New Puritans. Wenige Tage später kam ein weiteres hinzu, A Western Circular von Weirdo-Beatmaker Wilma Archer. Viel mehr werden in Zukunft nicht hinzukommen.
Musikmagazin zum Anhören
Fürs Erste werden zehn verschiedene Alben erhältlich sein, die Auswahl tauscht sich nach dem Rotationsprinzip monatlich aus. Begleitet wird dafür die Musik von journalistischen Einordnungen und Kritiken. Gründer Aaron Starkes spricht von seiner Plattform als „Musikmagazin zum Anhören“. Er hat bei Indie-Labels gearbeitet und ist selbst Journalist. „Viele Menschen beschweren sich, dass im Streaming der Kontext verloren geht“, sagt er.
Seine Plattform soll jenen Kontext liefern – und dem Publikum ein tiefergehendes Hörerlebnis bieten. Deshalb ist Cantilever, wie Starkes betont, nicht als Konkurrenz zu regulären Angeboten zu verstehen. Vielmehr sei es ein „Sprungbrett“, über das Fans neue Alben entdecken und in der Folge nachhaltige Beziehungen zu ihnen aufbauen sollen. Immer wieder hört Starkes, dass Hörer:innen Tickets oder Platten der vorgestellten Artists gekauft hätten. Nicht nur so soll Cantilever ihnen und ihren Labels einen lukrativen Zuverdienst zum regulären Streaming bieten.
Denn zum einen ist der Konkurrenzdruck um Tantiemen um ein Millionenfaches geringer als anderswo, zum anderen wird das Geld nach dem sogenannten „nutzerzentrierten“ Prinzip verteilt, das entsprechend dem Hörverhalten ausschüttet: Wenn jemand in einem Abrechnungsmonat nur einen einzelnen Song hört, gehen 70 Prozent der individuellen Aboeinnahmen in Höhe von 5,99 Euro an dessen Rechteinhaber:innen.
Das unterscheidet Cantilever von fast allen anderen Streamern, wo nach dem sogenannten Pro-Rata-Prinzip verteilt wird: Ausgeschüttet wird da nach dem Anteil eines Songs am gesamten Streamingaufkommen. Wenn innerhalb eines Monats also die Hälfte der Streams auf die neue Taylor-Swift-Single entfielen, geht die Hälfte aller Gelder an deren Rechteinhaber:innen – egal, wer dort was gestreamt hat.
Kontextmaschinen statt Content-Schleudern
Das Pro-Rata-Prinzip wurde zuletzt immer härter kritisiert: Die großen Stars würden übervorteilt. Allerdings gibt es Streamer, die einen vergleichbar großen Katalog anbieten und selbst im Rahmen eines Pro-Rata-Modells besser zahlen wollen. Sie richten sich an ein potenziell kleineres Publikum und wollen als Kontextmaschinen statt als Content-Schleudern fungieren. Das französische Unternehmen Qobuz ist in Deutschland seit 2013 am Markt, lange Zeit hob sich die Plattform mit hoher Klangqualität ab. „Da sind andere Plattformen inzwischen nachgezogen, aber der harte Kern des audiophilen Publikums vertraut immer noch auf uns“, sagt Deutschland-Managerin Mareile Heineke. Wie Cantilever bietet Qobuz journalistische Inhalte, Empfehlungen werden einer 30-köpfigen Redaktion überlassen und nicht dem Algorithmus.
Lange richtete sich Qobuz an eine spezielle Zielgruppe – „böse formuliert: alte weiße Männer“, lacht Heineke –, doch hat die Plattform zuletzt Zuwachs bekommen, das Publikum diversifiziert. Das liegt daran, dass die Kritik an den als unfair wahrgenommenen Ausschüttungsmodalitäten zugenommen hatte und vor allem Spotify immer mehr unter Beschuss geriet.
Qobuz vermeldete im Frühjahr 2025, es habe im Vorjahr durchschnittlich 1,8 Cent pro Stream ausgeschüttet – keine andere Plattform macht solche Zahlen öffentlich. Weil die Ausschüttungsmechanismen extrem komplex sind, variieren Schätzungen. Es kann davon ausgegangen werden, dass Qobuz ein Vielfaches davon zahlt, was von Spotify und Co. zu erwarten ist.
Es ist nicht unser Ansatz, Playlist-Content anzubieten, der möglichst wenig stört und konstant im Hintergrund läuft. Unsere Nutzer:innen hören bewusster
Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Zum einen ruft Qobuz vergleichsweise hohe Abopreise auf. Wo mehr Einnahmen sind, kann auch mehr ausgezahlt werden. Zum anderen macht das Hörverhalten des Publikums den Unterschied, erklärt Heineke: „Es ist nicht unser Ansatz, Playlist-Content anzubieten, der möglichst wenig stört und konstant im Hintergrund läuft. Unsere Nutzer:innen hören bewusster.“ Heißt: Sie hören weniger. Im Rahmen des Pro-Rata-Modells bedeutet dies, dass die höheren Aboeinnahmen auf weniger Musikstücke verteilt werden – und sich der finanzielle Mittelwert anhebt. Sollte Qobuz mehr Hörer:innen anziehen, könnte die Rechnung kleinteiliger werden. Doch Heineke will Qobuz weiter ausbauen: „Wir setzen uns nach oben keine Grenzen.“
Nicht mehr um die Reste prügeln
Wenn Alexander Landenburg auf die Tantiemenrechnungen von Qobuz angesprochen wird, muss er lachen: „Genau das war von Anfang an unser Konzept!“ Er ist Schlagzeuger bei diversen Metal-Bands und konzipierte mit einem befreundeten Geschäftsmann während des pandemiebedingten Stillstands einen Streamingdienst. Er sollte sich an ein kleines Publikum richten, damit für harte Gitarrenmusik größere Zahlungen fließen. Rokk startete im März letzten Jahres. Die Ästhetik und die redaktionellen Angebote sind an die Interessen und Bedürfnisse von Rock- und Metal-Fans angepasst. „Viele denken, sie bräuchten einen zweiten Streamingservice, um alles zu hören“, sagt Landenburg.
Bei Plattformen, die sich an ein Mainstream-Publikum richten, ist das so, als würde das kleine Restaurant im Dorf zusammen mit McDonald’s die Abrechnung machen
Das sei nicht der Fall. Rokk bietet weitgehend denselben Katalog wie andere Plattformen – neben Black Metal auch Pop und Underground-Hip-Hop. Warum sich überhaupt an eine spezielle Zielgruppe wenden? „In der Nische kennen wir uns aus, fühlen uns darin wohl“, sagt Landenburg. Am Anfang stand dieselbe Überlegung, die Qobuz mit der Offenlegung der durchschnittlichen Auszahlungen praktisch beweisen konnte: Der inhaltliche Fokus soll Rock- und Metal-Bands ermöglichen, mehr Geld zu verdienen. Landenburg zufolge wird Nischenmusik im Streaming benachteiligt, weil die kleine Doom-Metal-Band sich prozentual an den Streams von Bad Bunny messen muss: „Bei Plattformen, die sich an ein Mainstream-Publikum richten, ist das so, als würde das kleine Restaurant im Dorf zusammen mit McDonald’s die Abrechnung machen“, sagt er.
Wird das Fast Food aus der Gleichung gestrichen, könne das zur sanften Umverteilung führen. „Im Dezember lagen wir bei über zwei Cent pro Stream – etwa dem Siebenfachen von dem, was laut Schätzungen bei Spotify herumkommt“, erklärt der Rokk-Gründer. Wie bei Qobuz ist die moderate Größe des Publikums ein Faktor. Langfristig, meint Landenburg, werde Rokk das „Fünffache vom Marktdurchschnitt“ zahlen können.
Auch bietet Rokk die Möglichkeit, per sogenanntem Direct Support Bands mit Teilen aus Abozahlungen zu unterstützen. Etwa sieben Euro pro Jahr würden damit direkt an Rechteinhaber:innen fließen – bei einem Fan zahlt das vielleicht nur einen Satz Saiten, bei hundert aber schon ein paar Proberaummieten. Anders als bei Cantilever unterscheidet sich das Musikangebot von Qobuz und Rokk kaum von dem von Spotify und Co. Bei allen liegt der Fokus auf dem bewussten Hören und damit einer kleineren Zielgruppe. Vor allem gilt das in wirtschaftlicher Hinsicht für diejenigen, um deren kreatives Wirken es geht: Musiker:innen, die sich sonst an den Vollfress-Buffets der großen Konkurrenz um die letzten Krumen schlagen müssen.
bene Radiostationen. Mittels solcher Alleinstellungsmerkmale wollen große Plattformen ihr Wachstum antreiben. Allerdings versuchen zunehmend mehr Dienste, sich gar nicht als All-you-can-hear-Buffets dem größtmöglichen Publikum anzubieten. Qobuz, Rokk und Cantilever möchten bewussteren Musikkonsum fördern – und dabei Acts besser zahlen. Als Cantilever am 14. Januar in Deutschland startete, bot er auf den ersten Blick herzlich wenig – ein einziges Album, um genau zu sein: Crooked Wing von der Drama-Pop-Band These New Puritans. Wenige Tage später kam ein weiteres hinzu, A Western Circular von Weirdo-Beatmaker Wilma Archer. Viel mehr werden in Zukunft nicht hinzukommen. Musikmagazin zum AnhörenFürs Erste werden zehn verschiedene Alben erhältlich sein, die Auswahl tauscht sich nach dem Rotationsprinzip monatlich aus. Begleitet wird dafür die Musik von journalistischen Einordnungen und Kritiken. Gründer Aaron Starkes spricht von seiner Plattform als „Musikmagazin zum Anhören“. Er hat bei Indie-Labels gearbeitet und ist selbst Journalist. „Viele Menschen beschweren sich, dass im Streaming der Kontext verloren geht“, sagt er.Seine Plattform soll jenen Kontext liefern – und dem Publikum ein tiefergehendes Hörerlebnis bieten. Deshalb ist Cantilever, wie Starkes betont, nicht als Konkurrenz zu regulären Angeboten zu verstehen. Vielmehr sei es ein „Sprungbrett“, über das Fans neue Alben entdecken und in der Folge nachhaltige Beziehungen zu ihnen aufbauen sollen. Immer wieder hört Starkes, dass Hörer:innen Tickets oder Platten der vorgestellten Artists gekauft hätten. Nicht nur so soll Cantilever ihnen und ihren Labels einen lukrativen Zuverdienst zum regulären Streaming bieten. Denn zum einen ist der Konkurrenzdruck um Tantiemen um ein Millionenfaches geringer als anderswo, zum anderen wird das Geld nach dem sogenannten „nutzerzentrierten“ Prinzip verteilt, das entsprechend dem Hörverhalten ausschüttet: Wenn jemand in einem Abrechnungsmonat nur einen einzelnen Song hört, gehen 70 Prozent der individuellen Aboeinnahmen in Höhe von 5,99 Euro an dessen Rechteinhaber:innen.Das unterscheidet Cantilever von fast allen anderen Streamern, wo nach dem sogenannten Pro-Rata-Prinzip verteilt wird: Ausgeschüttet wird da nach dem Anteil eines Songs am gesamten Streamingaufkommen. Wenn innerhalb eines Monats also die Hälfte der Streams auf die neue Taylor-Swift-Single entfielen, geht die Hälfte aller Gelder an deren Rechteinhaber:innen – egal, wer dort was gestreamt hat. Kontextmaschinen statt Content-SchleudernDas Pro-Rata-Prinzip wurde zuletzt immer härter kritisiert: Die großen Stars würden übervorteilt. Allerdings gibt es Streamer, die einen vergleichbar großen Katalog anbieten und selbst im Rahmen eines Pro-Rata-Modells besser zahlen wollen. Sie richten sich an ein potenziell kleineres Publikum und wollen als Kontextmaschinen statt als Content-Schleudern fungieren. Das französische Unternehmen Qobuz ist in Deutschland seit 2013 am Markt, lange Zeit hob sich die Plattform mit hoher Klangqualität ab. „Da sind andere Plattformen inzwischen nachgezogen, aber der harte Kern des audiophilen Publikums vertraut immer noch auf uns“, sagt Deutschland-Managerin Mareile Heineke. Wie Cantilever bietet Qobuz journalistische Inhalte, Empfehlungen werden einer 30-köpfigen Redaktion überlassen und nicht dem Algorithmus. Lange richtete sich Qobuz an eine spezielle Zielgruppe – „böse formuliert: alte weiße Männer“, lacht Heineke –, doch hat die Plattform zuletzt Zuwachs bekommen, das Publikum diversifiziert. Das liegt daran, dass die Kritik an den als unfair wahrgenommenen Ausschüttungsmodalitäten zugenommen hatte und vor allem Spotify immer mehr unter Beschuss geriet. Qobuz vermeldete im Frühjahr 2025, es habe im Vorjahr durchschnittlich 1,8 Cent pro Stream ausgeschüttet – keine andere Plattform macht solche Zahlen öffentlich. Weil die Ausschüttungsmechanismen extrem komplex sind, variieren Schätzungen. Es kann davon ausgegangen werden, dass Qobuz ein Vielfaches davon zahlt, was von Spotify und Co. zu erwarten ist. Es ist nicht unser Ansatz, Playlist-Content anzubieten, der möglichst wenig stört und konstant im Hintergrund läuft. Unsere Nutzer:innen hören bewussterMareile Heineke, Deutschland-Managerin QobuzDie Gründe dafür sind unterschiedlich. Zum einen ruft Qobuz vergleichsweise hohe Abopreise auf. Wo mehr Einnahmen sind, kann auch mehr ausgezahlt werden. Zum anderen macht das Hörverhalten des Publikums den Unterschied, erklärt Heineke: „Es ist nicht unser Ansatz, Playlist-Content anzubieten, der möglichst wenig stört und konstant im Hintergrund läuft. Unsere Nutzer:innen hören bewusster.“ Heißt: Sie hören weniger. Im Rahmen des Pro-Rata-Modells bedeutet dies, dass die höheren Aboeinnahmen auf weniger Musikstücke verteilt werden – und sich der finanzielle Mittelwert anhebt. Sollte Qobuz mehr Hörer:innen anziehen, könnte die Rechnung kleinteiliger werden. Doch Heineke will Qobuz weiter ausbauen: „Wir setzen uns nach oben keine Grenzen.“Nicht mehr um die Reste prügelnWenn Alexander Landenburg auf die Tantiemenrechnungen von Qobuz angesprochen wird, muss er lachen: „Genau das war von Anfang an unser Konzept!“ Er ist Schlagzeuger bei diversen Metal-Bands und konzipierte mit einem befreundeten Geschäftsmann während des pandemiebedingten Stillstands einen Streamingdienst. Er sollte sich an ein kleines Publikum richten, damit für harte Gitarrenmusik größere Zahlungen fließen. Rokk startete im März letzten Jahres. Die Ästhetik und die redaktionellen Angebote sind an die Interessen und Bedürfnisse von Rock- und Metal-Fans angepasst. „Viele denken, sie bräuchten einen zweiten Streamingservice, um alles zu hören“, sagt Landenburg.Bei Plattformen, die sich an ein Mainstream-Publikum richten, ist das so, als würde das kleine Restaurant im Dorf zusammen mit McDonald’s die Abrechnung machenAlexander Landenburg, Mitgründer Rokk Das sei nicht der Fall. Rokk bietet weitgehend denselben Katalog wie andere Plattformen – neben Black Metal auch Pop und Underground-Hip-Hop. Warum sich überhaupt an eine spezielle Zielgruppe wenden? „In der Nische kennen wir uns aus, fühlen uns darin wohl“, sagt Landenburg. Am Anfang stand dieselbe Überlegung, die Qobuz mit der Offenlegung der durchschnittlichen Auszahlungen praktisch beweisen konnte: Der inhaltliche Fokus soll Rock- und Metal-Bands ermöglichen, mehr Geld zu verdienen. Landenburg zufolge wird Nischenmusik im Streaming benachteiligt, weil die kleine Doom-Metal-Band sich prozentual an den Streams von Bad Bunny messen muss: „Bei Plattformen, die sich an ein Mainstream-Publikum richten, ist das so, als würde das kleine Restaurant im Dorf zusammen mit McDonald’s die Abrechnung machen“, sagt er.Wird das Fast Food aus der Gleichung gestrichen, könne das zur sanften Umverteilung führen. „Im Dezember lagen wir bei über zwei Cent pro Stream – etwa dem Siebenfachen von dem, was laut Schätzungen bei Spotify herumkommt“, erklärt der Rokk-Gründer. Wie bei Qobuz ist die moderate Größe des Publikums ein Faktor. Langfristig, meint Landenburg, werde Rokk das „Fünffache vom Marktdurchschnitt“ zahlen können. Auch bietet Rokk die Möglichkeit, per sogenanntem Direct Support Bands mit Teilen aus Abozahlungen zu unterstützen. Etwa sieben Euro pro Jahr würden damit direkt an Rechteinhaber:innen fließen – bei einem Fan zahlt das vielleicht nur einen Satz Saiten, bei hundert aber schon ein paar Proberaummieten. Anders als bei Cantilever unterscheidet sich das Musikangebot von Qobuz und Rokk kaum von dem von Spotify und Co. Bei allen liegt der Fokus auf dem bewussten Hören und damit einer kleineren Zielgruppe. Vor allem gilt das in wirtschaftlicher Hinsicht für diejenigen, um deren kreatives Wirken es geht: Musiker:innen, die sich sonst an den Vollfress-Buffets der großen Konkurrenz um die letzten Krumen schlagen müssen.