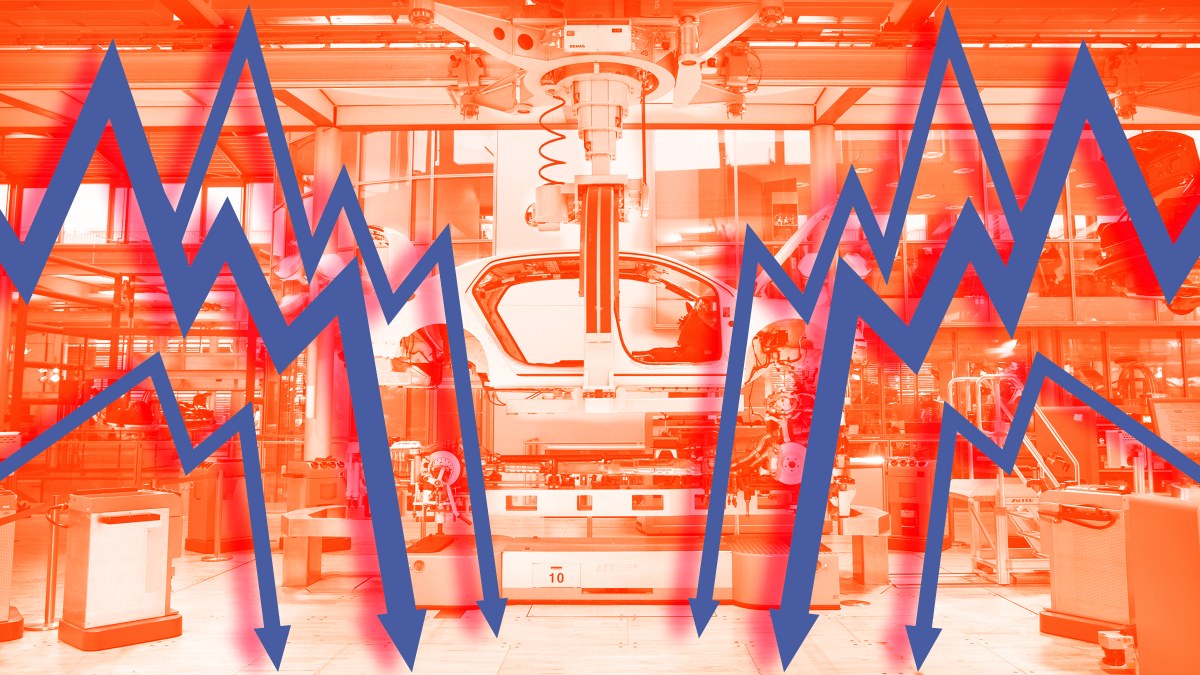Der Niedergang der deutschen Wirtschaft zeigt sich nicht nur in abstrakten Zahlen. Er trifft vor allem Menschen: Azubis, Sozialarbeiterinnen oder Wirte. Hier kommen fünf von ihnen zu Wort, deren Jobs bedroht oder schon verloren sind
Montage: der Freitag, Foto: Thomas Trutschel/photothek.net/Imago
Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise. Aber was heißt das eigentlich? Heißt es, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagniert, wie es die Bundesregierung für 2025 das dritte Jahr in Folge erwartet? Heißt es, dass die Verkaufszahlen der Konzerne sinken Oder heißt es, dass die deutschen Exporte dieses Jahr laut offiziellen Berechnungen um 2,2 Prozent zurückgehen werden?
Wenn es nur das wäre, die Krise könnte den meisten Menschen gleichgültig sein.
Auch wenn es in der Berichterstattung oft so wirkt, äußert sie sich nicht nur in abstrakten Wirtschaftskennzahlen. Wirtschaftskrise heißt auch, dass die Auszubildende nicht weiß, ob ihr Ausbildungsstandort noch ausreichend lange besteht, dass sie dort ihre Lehre zu Ende b
Wirtschaftskennzahlen. Wirtschaftskrise heißt auch, dass die Auszubildende nicht weiß, ob ihr Ausbildungsstandort noch ausreichend lange besteht, dass sie dort ihre Lehre zu Ende bringen kann. Dass der Wirt sein einst florierendes Restaurant schließt, weil weder er noch seine Gäste die gestiegenen Kosten stemmen können. Oder dass die Sozialarbeiterin ihre Beratungsstelle schließen muss, nachdem die Stadt ihr aufgrund knapper Kassen die Förderung entzieht.Diese Menschen sind die ersten, die die Krise spüren — und bleiben doch weniger präsent als Ökonomen, Wirtschaftsbosse und Politikerinnen, die die Abschaffung von Feiertagen, Senkung von Unternehmenssteuern und Demontage von Sozialleistungen für die Ärmsten fordern. Es sind Menschen aus Fleisch und Blut, die Jobs verlieren, mit Zukunftsängsten kämpfen und Lebensträume aufgeben müssen. Der Freitag hat mit fünf von ihnen gesprochen und die Gespräche aus ihrer Perspektive protokolliert.Ramona Fischer (40): Die LageristinPlaceholder image-1Ich habe sehr gerne für Baur gearbeitet, sonst wäre ich nicht 14 Jahre geblieben. Als im November eine spontane Mitarbeiterversammlung angekündigt wurde, hatte ich schon ein schlechtes Gefühl, das sich dann leider bestätigt hat. Wir wussten schon länger, dass unser Großkunde s.Oliver wegfällt, weil der Vertrag ausläuft und der ein eigenes Lager aufmacht. Aber dass wir keinen neuen Kunden finden würden und deswegen die gesamte Warenherstellung in Weismain (Bayern) dichtmachen muss? Nein, das wussten wir natürlich nicht. 429 Kündigungen wurden insgesamt ausgesprochen. Eine davon war meine.14 Jahre habe ich Vollzeit für den oberfränkischen Versandhändler gearbeitet. Meine Kolleginnen waren wie eine Familie für mich. Ich war zuständig für die Bearbeitungen von Bestellungen, habe verpackt und Retouren bearbeitet. Weil ich so stottere, hatte ich wenig Kundenkontakt, bin im Lager geblieben. Aber das wollte ich ja auch, ich kann eben nicht im Callcenter arbeiten. Aktuell arbeite ich noch ein bisschen, Aufräumarbeiten und so, aber ab Juni ist endgültig Schluss und dann bekomme ich auch kein Gehalt mehr.Über meinen Arbeitgeber kann ich aber wirklich nichts Schlechtes sagen, der war uns sehr wohlgesonnen, wir haben über Mindestlohn bekommen. Ich war positiv überrascht, wie uns von Anfang an geholfen wurde: Wir wurden nicht einfach auf die Straße gesetzt, sondern es wurde eine Jobbörse organisiert und das Arbeitsamt direkt miteingeschlossen. Also, so was macht ja nicht jede Firma, bei der ein Betrieb schließt. Und es war toll, für Baur zu arbeiten, eigentlich ein kleiner Traum, denn als Kind habe ich mir immer schon gerne den Baur-Katalog angeschaut.Ich bin gelernte Modenäherin, aber schon nach Ausbildungsabschluss mit Mitte 20 hatte ich keine Jobaussicht in der Branche. Da war Baur eine gute Alternative. Heute könnte ich schon gar nicht mehr als Näherin arbeiten, wegen des Rheumas. Und so lange sitzen? Nee, das geht nicht!Klar habe ich Sorge, keinen neuen Job zu finden, ich bin alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, das will nicht jeder Arbeitgeber. Und ich habe einen bestimmten Grad von Behinderung. Viele Kollegen, die wie ich gekündigt wurden, sind schon im älteren Semester, also über 50, das könnte auch schwierig werden. Aber ich versuche, zuversichtlich zu bleiben: Wenn man arbeiten will, findet sich schon irgendwas.Im Zweifel beziehe ich ab Juni erstmal Bürgergeld, beantrage einen Mietzuschuss, es gibt ja Möglichkeiten. Der Staat hilft da. Aber ich möchte unbedingt arbeiten. Auch für das eigene Gefühl.Martin Osterrieder (61): Der WirtPlaceholder image-2Das Gasthaus Siebenbrunn in München habe ich im Jahr 2012 gepachtet. Lange lief das Geschäft rund, aber zum Jahreswechsel musste ich schließen. Die Kosten waren einfach nicht mehr tragbar. Ich kann mich noch gut an den ersten Tag erinnern: Als das Gasthaus um 11:30 Uhr immer noch komplett leer war, habe ich langsam Panik bekommen. In Franken, wo ich herkomme, sind die Läden um diese Zeit längst voll! Als dann zwei Stunden später doch noch die Gäste kamen, habe ich gemerkt, dass die Münchner einfach einen anderen Rhythmus haben.Der Laden hat sich dann wunderbar entwickelt, wir hatten sieben Tage in der Woche geöffnet und mit unseren fränkischen Spezialitäten wie Schäufele und Karpfen jede Menge Stammgäste an uns gebunden. Auch mein Personal konnte ich von Anfang bis Ende halten – sicher auch, weil ich gut und immer pünktlich bezahlt habe. Wir haben damals um die 100.000 Küchenbons pro Jahr gemacht, das ist schon eine Leistung. Dann kam Corona.Aber auch durch die Pandemie sind wir mit den Überbrückungshilfen noch gut gekommen. Bis mir 2023 die Stadt München plötzlich keine Stromrechnungen mehr geschickt hat. Es hieß, dass das neue Gesetz vom Habeck so kompliziert ist, dass sie die Stromkosten nicht mehr berechnen können. Im November kamen dann alle Monatsrechnungen auf einmal: 4.300 Euro Stromkosten pro Monat. Bisher waren es immer um die 2.300 Euro gewesen. Da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Und dann wurde auch noch beim Gas eine Nachzahlung von 37.000 Euro verlangt. Ich habe dann Ratenzahlung vereinbart. Es half alles nichts. 2024 kamen zu allem Unglück dann auch immer weniger Kunden. Kein Wunder: Die hatten ja auch Nachzahlungen zu leisten. Familien, die früher jeden Samstag da waren, haben mir gesagt, dass es auch bei ihnen finanziell enger wird. Das Geschäft lief also schlechter, und dann kam auch noch die Umsatzsteuererhöhung.Das hat die Katastrophe perfekt gemacht. Ich habe 2024 dann um die 250.000 Euro in den Sand gesetzt. Das kann ich mir ein Jahr lang leisten, dann bin ich pleite. Spätestens da wusste ich: Ich hör auf. Die letzten Wochen war dann jeden Tag wie eine große Familienfeier mit meinen Stammgästen. Jetzt, wo mein Restaurant zu ist, bin ich mit meiner Lebensgefährtin nach Polen gezogen. Für die Müllabfuhr zahlen wir hier 150 Euro pro Jahr, und für den Strom bezahlen wir, auch dank eigener Solaranlage, nur rund 30 Euro. Preise, die in Deutschland schon lange nicht mehr vorstellbar sind.Claudia Döring (51): Die SozialpädagoginPlaceholder image-3Fast genau vor 10 Jahren habe ich mit einer Kollegin die Fachstelle für die Arbeit mit Mädchen* und jungen Frauen* in Dresden gegründet. Letzten Monat haben wir unser Büro geräumt – die Stadt hat uns die Förderung gestrichen.In der Jugendarbeit ist der Geschlechteraspekt ein super wichtiges Thema – Mädchen haben oft ganz andere Bedürfnisse und Probleme als Jungs. Trotzdem gab es in Dresden lange eine Beratungsstelle für die Arbeit mit Jungen, aber nicht für die mit Mädchen. Das haben wir geändert. Ich habe nicht direkt mit Mädchen gearbeitet, sondern Sozial- und Jugendarbeiter:innen in ganz Dresden unterstützt. Wenn zum Beispiel ein Kollege gemerkt hat, dass die Mädchen in seinem Jugendtreff Probleme mit weiblichen Schönheitsidealen oder sogar Magersucht entwickeln, konnte er bei uns Rat, Workshops und Literatur zum Thema finden. Themen wie Magersucht und selbstverletzendes Verhalten sind Probleme, die gerade seit Corona komplett durch die Decke gehen.Umso schlimmer ist, dass die Stadt Dresden nicht nur meiner Beratungsstelle, sondern der gesamten Jugendarbeit die Mittel kürzt oder komplett streicht – das Geld sei einfach nicht mehr da, heißt es.Der Brief mit der Nachricht von der kompletten Streichung meiner Stelle kam schon letzten September, trotzdem hat der Stadtrat noch Monate gebraucht, um den Kürzungshaushalt endgültig zu beschließen. Die Jugendarbeit in Dresden hat die Zeit genutzt, sich zu sammeln und Proteste zu organisieren. Wir haben zwar noch einige Verbesserungen erreicht, aber meine Fachstelle musste trotzdem Ende letzten Monats ihr Büro räumen.Für mich ist es auch eine persönliche Kränkung, nach so vielen Jahren erfolgreicher Arbeit den Stuhl vor die Tür gesetzt zu bekommen. Viel wichtiger ist aber, dass die Kürzungen in der Jugendarbeit in Dresden auch Symptom eines gesellschaftlichen Rechtsrucks sind, der Themen wie Geschlechtergerechtigkeit und psychische Gesundheit an den Rand drängt. Das zu sehen, macht mir große Angst. Seit Anfang des Monats arbeite ich als Sozialarbeiterin an einer Dresdner Schule. Ich muss pragmatisch sein, immerhin muss ich eine Familie ernähren. Aber meine alte Stelle, bei der ich so vielen Kolleg:innen helfen konnte, war mein Traumjob. Ich hoffe einfach, dass es nochmal eine Entscheidung und ein Comeback geben wird.Ronja Matthes (22): Die AuszubildendePlaceholder image-4Vor einem halben Jahr habe ich in der Gläsernen Manufaktur, dem Dresdner VW-Werk, meine Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin angefangen. Aber ob ich sie hier auch abschließen kann, steht in den Sternen.Schon als Kind habe ich andauernd gebastelt und gehandwerkt. Kein Wunder, dass ich bei VW gelandet bin. Wenn man an einem Auto vorbeigeht und sagen kann: Ha, ich weiß genau, wie das funktioniert – das ist einfach cool. Über die Zukunft der Gläsernen Manufaktur gab es schon jede Menge Unsicherheit, als ich angefangen habe. Inzwischen ist klar: Ende 2025 werden hier keine Autos mehr hergestellt. Kündigungen soll es zwar keine geben, aber was in der Manufaktur ab nächstem Jahr passieren wird, weiß noch niemand.Das ist schade, denn ich liebe das Schrauben an Autos, obwohl man es als Frau in der Technik deutlich schwerer hat als jeder männliche Kollege. In meiner Berufsschule gibt es nur zwei Damentoiletten im ganzen Haus, aber zwei Herrenklos auf jedem Stock. Und wenn man immer wieder Witze über Frauen und Autos hören muss, ist das einfach nur eklig. Ich kämpfe sehr laut gegen dieses Gehabe, weniger für mich als für die sechzehnjährigen Mädchen in meiner Berufsschule, die von irgendwelchen Kerlen demotiviert werden. Das Tolle ist, dass VW dabei immer zu hundert Prozent an meiner Seite steht. Das kann in einer kleinen Autowerkstatt ganz anders sein.Umso trauriger, dass Volkswagen ziemlich intransparent ist, was die Zukunft der Gläsernen Manufaktur betrifft. Gefühlt steht alle zwei Wochen etwas Neues in der Zeitung, und wir stehen morgens da und fragen uns gegenseitig, ob jemand das schon vorher mitbekommen hat. Wenn sich das Management uns mal zeigt, frage ich jedes Mal, was denn jetzt aus uns wird. Dann kommen Antworten wie: „Können wir noch nicht sagen, aber man muss ja auch nicht sein ganzes Leben in Dresden verbringen.“ Ich kann damit umgehen, aber ich kann mir vorstellen, dass gerade die jüngeren Kollegen da ziemlich Angst kriegen.Vielleicht kann ich meine Ausbildung hier trotzdem zu Ende bringen, zum Beispiel in der Entwicklung. Es kann aber auch sein, dass ich ins Zwickauer oder Chemnitzer Werk wechseln muss. Dabei habe ich in Dresden meine Familie, mein Zuhause und meinen Freundeskreis. Mir bleibt nichts übrig, als das Beste zu hoffen, denn ich liebe die Gläserne Manufaktur und will sie nicht verlieren.Knut Schoknecht (58): Der WerkarbeiterPlaceholder image-5Als ich 1986 im VEB Elektrowerkzeuge Sebnitz als Monteur angefangen habe, war ich noch ein junger Mann. Heute bin ich 58 Jahre alt und arbeite immer noch im selben Werk, das inzwischen zu Bosch gehört. Aber Anfang April wurde uns bei einer Betriebsversammlung auf der vierten Folie der Powerpoint-Präsentation verkündet: Unser Sebnitzer Werk mit 280 Mitarbeitern soll bis spätestens Ende 2026 geschlossen werden.Dabei hatte Sebnitz nach der Wende wirklich Glück: Die damalige Geschäftsführung des Volkseigenen Betriebes ist im Lada nach Stuttgart gefahren, um sich bei Bosch anzubieten – und tatsächlich wurde das Werk übernommen. Ich selbst war so in der Wendezeit einige Monate in Kurzarbeit, aber nie arbeitslos. Dafür bin ich Bosch immer dankbar gewesen.Wir stellen hier im sächsischen Sebnitz unter anderem Bohr- und Schlaghammer her. Ich koordiniere inzwischen vier Behindertenwerkstätten in der Region, die unserem Werk zuliefern. Für die ist die Werkschließung natürlich auch eine Katastrophe, genau wie für viele andere Zulieferer, bis hin zum örtlichen Bäcker und Fleischer.Die Werkschließung trifft die ganze Region hart. Ich bin nur einer von vielen.Seit vierzehn Jahren bin ich alleinerziehend, mittlerweile habe ich zwei Kinder großgezogen. Meine Tochter ist im ersten Jahr ihrer Ausbildung. Wie gut ich sie dabei weiter unterstützen kann, weiß ich nicht. Das kommt ganz darauf an, wie die Abwicklung des Werks abläuft, und was genau nun auf uns zukommt. Was man so hört, kann es der Geschäftsleitung gar nicht schnell genug gehen, und die Schließung könnte schon deutlich früher kommen als Ende 2026. Wie man mit den Menschen hier umgeht, hat mit Ethik nichts mehr zu tun. Wir sind hier nicht naiv, und dass die globale Wirtschaft heute anders tickt als vor 20 Jahren ist mir auch klar.Hier kostet ein Mittagessen fünf Euro, in China einen Bruchteil davon. Aber daran sind ja nicht wir Monteure und Arbeiter Schuld, sondern die Politik. Warum die Energie so teuer geworden ist, kann ich zum Beispiel nicht nachvollziehen.Aber auch die Firma Bosch betreibt Raubbau an den Werten ihres Gründers. Das zu sehen, tut wirklich weh. Es braucht ein Umdenken in der Politik und in den Führungsriegen der Unternehmen, damit die Abwanderung der Industrie nicht immer weiter geht. Ich wünsche mir, dass ein großes Unternehmen wie Bosch einmal feststellt: „Wir halten unsere Arbeitsplätze in Deutschland“. Das wäre ein starkes Signal an die ganze Wirtschaft.