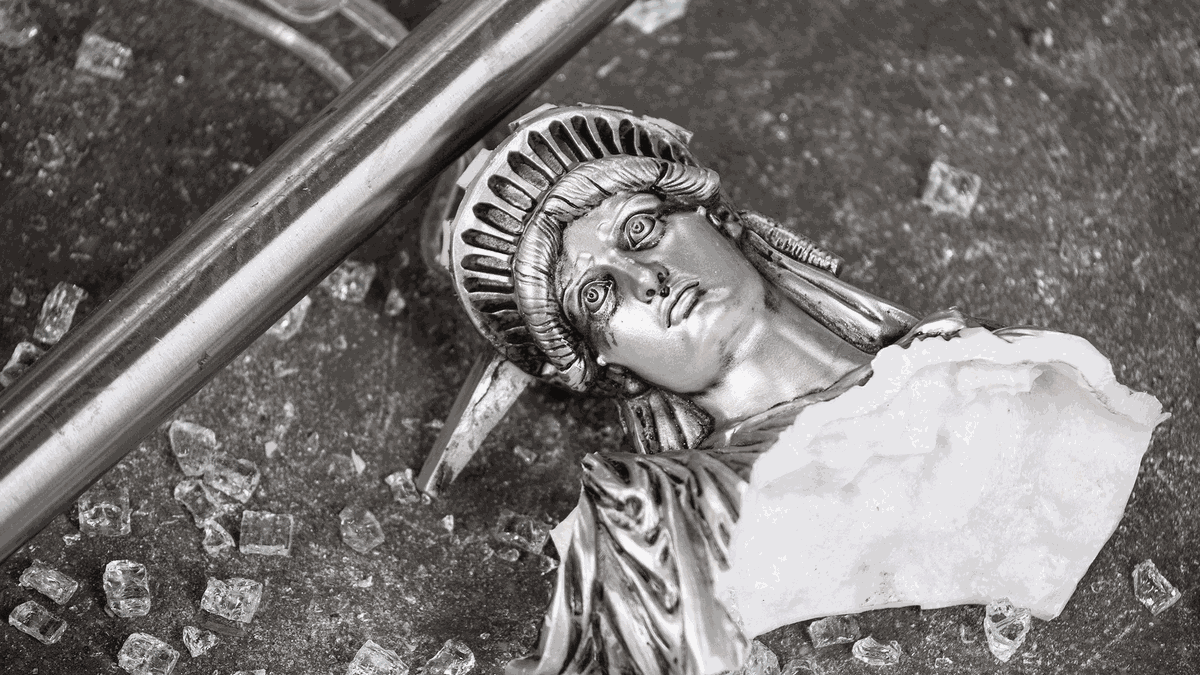Verkehrte Welt: Die US-Regierung treibt die Weltwirtschaft mit ihren Zöllen in die Krise. Alle anderen verteidigen den Freihandel gegen Trump. Dabei war es doch die Linke, die die Ungerechtigkeit der Globalisierung stets kritisierte
Die Freiheitsstatue steht nicht für Neoliberalismus oder Protektionismus – eine linke Standortbestimmung
Foto: Johannes Eisele/AFP/Getty Images
Die viele Jahre als Hort des Neoliberalismus geltenden USA haben unter der Trump-Regierung ein gewaltiges Zollpaket verabschiedet – das wirft Fragen auf. Ist die Kritik des Freihandels nun rechts? Und ist es heute links, ihn zu verteidigen? Diese Wahrnehmung jedenfalls haben derzeit die Studentinnen und Studenten von US-amerikanischen Freunden, die an nordamerikanischen Hochschulen politische Ökonomie lehren und damit auch die klassisch linken Kritik am sogenannten Freihandel. Die Studenten argwöhnen:Ist mein Dozent etwa Trump-Anhänger?
Das Ende vom „Ende der Geschichte“
Die Kritik am Freihandel war und ist eigentlich links. Ich war 14 Jahre alt, als am 1. Januar 1994, dem Tag des Inkrafttretens des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA), der Aufstan
n argwöhnen:Ist mein Dozent etwa Trump-Anhänger?Das Ende vom „Ende der Geschichte“Die Kritik am Freihandel war und ist eigentlich links. Ich war 14 Jahre alt, als am 1. Januar 1994, dem Tag des Inkrafttretens des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA), der Aufstand der indigenen Guerilla EZLN, der Zapatistischen Armee für die Nationale Befreiung, im mexikanischen Chiapas begann. Das Ereignis läutete bereits fünf Jahre nach der Verkündung vom „Ende der Geschichte“ durch den Politikwissenschaftler Francis Fukuyama – 1989 nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion – das Ende dieser Erzählung ein. Die Anklage des durch eine Sturmhaube anonym bleibenden Subcomandante Marcos – „Wer muss um Verzeihung bitten und wer kann sie gewähren?“ – war der Weckruf für eine aus dem globalen Süden kommende Kritik der neoliberalen Globalisierung. Der Kapitalismus sollte das Beste sein, das möglich ist? Sie waren anderer Meinung.Der Kapitalismus sollte das Beste sein, das möglich ist? Sie waren anderer MeinungPlaceholder image-2Ich erfuhr damals über den Aufstand durch ein noch im selben Jahr von Andreas Simmen herausgegebenes Buch: „Mexiko – Aufstand in Chiapas“. Aus linker Romantik heraus zeichnete ich das Motiv des Subcomandante akribisch in Großformat ab. Es hing bis zum Schluss in meinem Kinderzimmer – mein erster Kontakt mit der Kritik der Globalisierung. Diese galt damals als Sachzwang, der die Nationalstaaten machtlos gegenüberstehen und der man sich darum, so das Mantra von neoliberalen Sozialdemokraten wie Bill Clinton, Tony Blair und Gerhard Schröder, von Arbeitgeberverbänden und marktradikalen Stiftungen, nur unterwerfen könne.Imperien ohne KolonienDie damalige Globalisierungskritik wandte sich gegen die Außenwirtschaftspolitik der kapitalistischen Zentren im „Westen“: Diese laufe auf einen informellen Imperialismus hinaus. Tatsächlich hat der Westen die Schuldenkrise der Entwicklungsländer in Folge der ersten (1973) und zweiten Ölkrise (1979/80) und in Folge der radikalen Leitzinserhöhung der US-Notenbank 1979 ausgenutzt: Er knüpfte seine Notkredite an die Bedingung einer Handelsöffnung sowie an Deregulierungen und die Privatisierung von Tafelsilber zugunsten westlicher Konzerne. Eine Politik von Imperien, aber ohne formelle Kolonien.Seit 1980 hat sich die globale Arbeiterklasse zahlenmäßig verdoppeltDas Ergebnis war die vertiefte Abhängigkeit des globalen Südens und die Hundert millionenfache Proletarisierung von Klein- und Subsistenzbauern. Die Konsequenz: Seit 1980 hat sich die globale Arbeiterklasse zahlenmäßig verdoppelt – und zwar weit überproportional zum allgemeinen Bevölkerungswachstum. Das Drama der Weltgeschichte lautet: Kapitalistische Durchdringung führt zu sogenannten Überschussbevölkerungen, weil sie traditionelle Lebensweisen zerstört, ohne allen Menschen einen Platz in der neuen profitgetriebenen Wirtschaft zu bieten. Europa entledigte sich seiner eigenen ein paar Jahrhunderte eher durch Siedlerkolonialismus in Übersee. Gegen die Menschen auf Suche nach Arbeit und Perspektive schottet sich der Westen dagegen heute ab: Das Mittelmeer ist ein Massengrab, die US-mexikanische Grenze ein Kriegsgebiet. Dagegen regte und regt sich Widerstand: Gegen die Freihandelsideologie und für die unabhängige Entwicklung im globalen Süden entwickelten sozialistische Ökonomen verschiedene Konzepte. Etwa den Panafrikanismus und andere Projekte der regionalen Integration. Oder das von dem Politökonomen Samir Amin geprägte „Delinking“ – Länder des globalen Südens sollen sich so bewusst aus der abhängigen Einbindung in die kapitalistische Weltwirtschaft lösen und selbstbestimmte Entwicklungswege verfolgen. Das Ziel: Afrika und Lateinamerika von den Fesseln des Imperialismus befreien.Von der Philosophie zur ÖkonomieIm Westen konnte man dies eine Weile lang ignorieren. Die Linke war auch mit sich selbst beschäftigt. An die Stelle der Beschäftigung mit der Ökonomie traten die Ideologie und Kultur, an die Stelle eines positiven Bezugs auf den Sozialismus traten die großen Anti’s: antifaschistisch, antirassistisch, antisexistisch, antinational, antideutsch, antispeziesistisch, anti-antisemitisch und so weiter.Das konnte aber nicht so bleiben. Die periodischen, vertieften Finanzkrisen im globalen Finanzmarktkapitalismus häuften sich – Mexikokrise (1994/95), Russlandkrise (1998/99), Asienkrise (1997/98), Argentinienkrise (1998/2002) – und rückten auch immer näher ins Zentrum, bis zur Enron- und Dot.com-Krise (2000/2001) in den USA.Die Linke war auch mit sich selbst beschäftigtDas war die Stunde der Globalisierungskritik. In Frankreich wurde Attac gegründet, eine Initiative für die Einführung der Tobin-Steuer, die spekulative Finanzmarktgeschäfte besteuern und dadurch eindämmen sollte. Der linke französische Starsoziologe Pierre Bourdieu wurde ihr intellektueller Schirmherr – er betonte, dass Globalisierung eigentlich bloß ein anderes Wort für Kapitalismus war. In Deutschland wurde das Buch „Politische Ökonomie der Finanzmärkte“ des Bremer Politökonomen Jörg Huffschmid, nach dem die Rosa-Luxemburg-Stiftung heute noch ihren Wirtschaftspreis benennt, zum Augenöffner.Placeholder image-1Und auch Hardt/Negris Empire und John Holloways Die Welt verändern, ohne die Macht zu übernehmen – zwei weitere Bestseller der Zeit – waren zwar Ausdruck eines antistaatlichen Denkens, aber zugleich Pamphlete für die globalisierungskritische Bewegung, die sich gegen die G7-, G8- und später G20-Gipfel richtete. Im Kleinen vollzogen linke Aktivisten damals den Marx’schen Weg nach: von der Philosophie zur politischen Ökonomie.Wo steht heute die Linke?Ist Trump also nun Vorkämpfer der Globalisierungs- und Freihandelskritik? Und ist die Linke heute Verteidigerin einer offenen Globalisierung?Auch der Autor hat sich im Freitag strikt gegen die Schutzzollpolitik der EU und der USA gerichtet, die sich gegen den Import von chinesischen E-Autos, Solaranlagen und so weiter richtet. Das ist zum einen konsequent: In der Arbeiterbewegung war es immer die Haltung, dass man Schutzzölle ablehnt.Einmal im Sinne des Friedens, denn auch mit Wirtschaft lässt sich Krieg führen, und Handelskriege waren historisch Vorboten von militärischen Kriegen. Dies zeigt die Fragmentierung des Welthandels nach 1878, die ins Wettrüsten sowie in die Großmächterivalität um Einflusssphären und koloniale Absatz- und Rohstoffmärkte mündete – begleitet von Nationalismus, Chauvinismus und Kriegsideologie.In der Arbeiterbewegung war es immer die Haltung, dass man Schutzzölle ablehntZugleich lehnten marxistische Führungsgestalten wie Clara Zetkin oder Rosa Luxemburg den Schutzzoll aber auch und vor allem im ganz praktischen Sinne der Lebenshaltungskosten der Arbeiterklasse ab. Die Handelsschranken zum Schutz etwa der Landwirtschaft sah man Ende des 19. Jahrhunderts als den Versuch, die Profite der Agrarunternehmer trotz nun globalisierter Agrarmärkte aufrechtzuerhalten – auf Kosten der Arbeiter, für die sich dadurch die Lebensmittelpreise verteuerten.Ist man also aus einer Arbeiterbewegungs- und Imperialismuskritischen Perspektive gegen Schutzzölle, wenn sie die eigenen starken Staaten im Westen errichten, aber für Schutzzölle, wenn sie es den schwachen Staaten erlauben, sich vom Druck des Imperialismus zu befreien? Das ist zum Teil richtig und zugleich zu einfach gedacht.Es war ein zentraler Kern der linken Globalisierungskritik, dass der Nationalstaat keineswegs machtlos und auf dem Rückzug oder gar am Ende sei. Der Kern der bahnbrechenden Analysen der kritischen internationalen politischen Ökonomie war, dass der Staat bei der Globalisierung des Kapitalismus Pate stand, ja ihr zentraler Akteur war. Das Einzige, was in den Prozessen geschwächt wurde, war der Sozialstaat, nicht aber der Staat an sich.Die entscheidenden UnterschiedeVor diesem Hintergrund birgt die Freihandelskritik von rechts einen wahren Kern und ist auch gerade deshalb für Arbeiter und Arbeiterinnen in wettbewerbsschwachen Industrien anschlussfähig. Die rechte Freihandelskritik formuliert so im Kern den Anspruch, dass geografische Räume, in denen sich das Kapital sammelt, auch von dieser Tätigkeit des Kapitals profitieren. Das ist auch ein linker Anspruch. Das Ziel, wieder demokratische Kontrolle über die Ökonomie zu erlangen, ist für alle Weltregionen fortschrittlich.Die linke Antwort heißt folglich nicht Schutzzölle, sondern KapitalverkehrskontrollenAber erstens richtet sich die linke Freihandelskritik weniger auf die Warenströme, sondern vielmehr auf die Kapitalströme. Denn die Möglichkeit zur freien Bewegung ist die „strukturale Macht“, die es dem Kapital ermöglicht, von Beschäftigten Lohnzurückhaltung und von Staaten Subventionen und Steuersenkungen zu erzwingen. Dies auch, weil der Staat im Kapitalismus ein kapitalistischer Staat ist, da seine Funktionen über die internationalen Finanzmärkte schuldenfinanziert sind und auf Gedeih und Verderb davon abhängen, dem Kapital ein investitionsfreundliches Klima zu schaffen – sonst droht Investitionsstreik. Die linke Antwort heißt folglich nicht Schutzzölle, sondern Kapitalverkehrskontrollen.Zweitens verkennt die rechte Freihandelskritik aus Arbeiterperspektive, dass ein Wirtschaftsnationalismus von Joe Biden wie auch der von Trump zwar ausländische Direktinvestitionen anlocken kann, von denen man sich Jobs und Wachstum verspricht. Aber bei privaten profitorientierten Konzernen geht dies freilich nur auf Kosten von hohen Subventionen und schlechten Arbeitsbedingungen. Wie man am Beispiel des US-Konzerns Tesla in Brandenburg sehen kann, geht das Kapital dorthin, wo es keine Gewerkschaften, niedrige Löhne und wenig Auflagen gibt.Drittens verkennt die rechte Freihandelskritik das Ausmaß der Abhängigkeit der westlichen Arbeiterklassen und ihres Lebensstandards von günstigen Konsumgüterimporten aus China und dem globalen Süden. Trump wurde von den Arbeitern gewählt, die wütend sind über die Inflation – aber der Handelskrieg wird die Inflation in noch drastischerer Weise verschärfen. Auch hier ist linke Kritik da, wo sie schon bei Zetkin, Luxemburg und Co. stand.Die wahre StärkeAm Ende des Tages verkennt die rechte Freihandelskritik, sofern sie ein Zweck an sich ist – und nicht (Erpressungs-)Mittel zum Zweck verbesserter Handelsbeziehungen und geistiger Eigentumsrechte – die Qualität des internationalen Handels. Die Leistungsbilanzdefizite der USA sind tatsächlich die Stärke und nicht die Schwäche des US-Imperialismus gewesen.In einem vom Dollar dominierten Weltsystem vermochten die USA Tribute aus der ganzen Welt abzuziehen, die sie am Ende des Tages nicht oder unter Wert bezahlen mussten. Aber genau dies erscheint dem ökonomischen Nationalismus tatsächlich als Verlustgeschäft – mit fatalen Folgen für die Weltwirtschaft und die Arbeiterklassen der Welt. Es wäre zu wünschen, dass dieses Verständnis auch bei linken Studenten wieder Anklang findet.