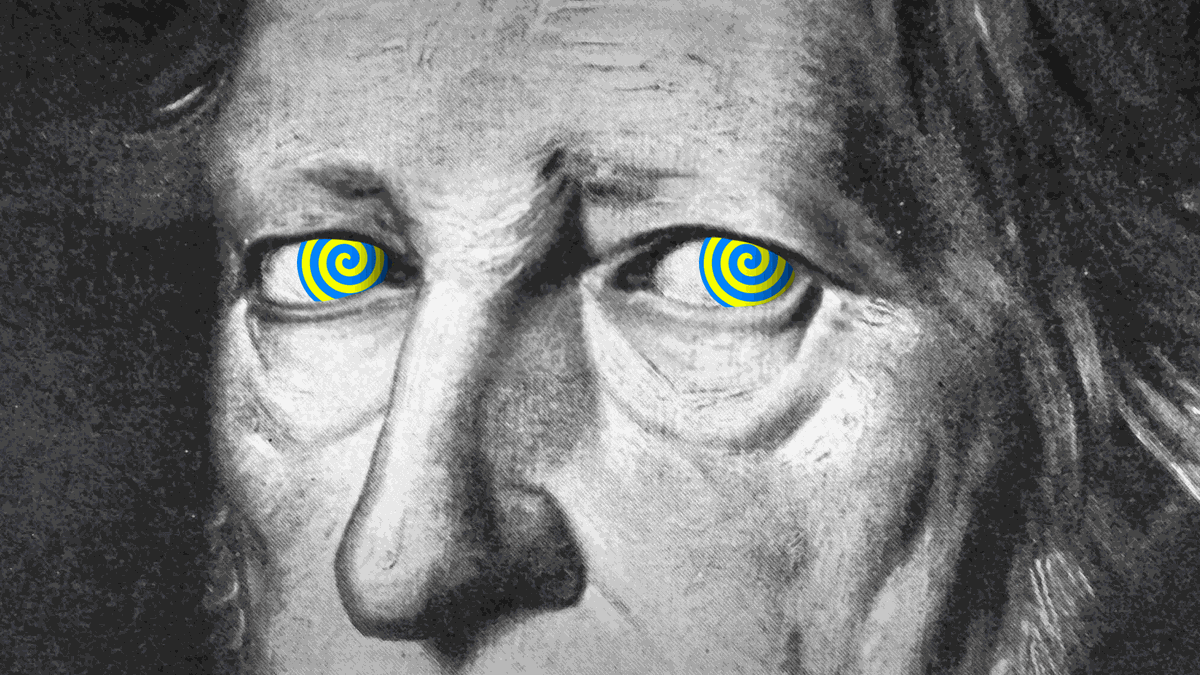Zunehmend versucht der Staat auf die öffentliche Debatte Einfluss zu nehmen. Eine Gesellschaft kann aber nur stabil sein, wenn es darin einen Raum für Dissens gibt
Was war die Freiheit, die er meinte? Philosoph G. W. F. Hegel (1770
Foto: der Freitag, Material: Imago Images
Wer sieht, was in jüngerer Zeit zum „Schutz der Demokratie“ gefordert oder verfügt wird, muss fragen, ob die Schutzmaßnamen nicht selbst zur Gefahr geworden sind. In den schwarz-roten Koalitionsverhandlungen stand das Informationsfreiheitsgesetz zumindest zeitweise zur Disposition, während die Medien titelten, das „Lügen“ solle verboten werden – womit keineswegs das Umschwenken des Friedrich Merz von „Schuldenbremse“ auf Mega-Kredite gemeint war. Seit 2021 kennen wir die „verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates“ – ohne klare Eingrenzung. „Hassrede“, „Hetze“ und „Desinformation“ werden energisch bekämpft, aber unscharf definiert. Staatlich mitfinanzier
ede“, „Hetze“ und „Desinformation“ werden energisch bekämpft, aber unscharf definiert. Staatlich mitfinanzierte NGOs beeinflussen den Diskurs. Die notorische Nähe zwischen Politik und Medien scheint zu wachsen.Ja, die neuen Medien bergen Risiken der Desinformation. Was aber jetzt geschieht, kann nicht die Antwort sein. Wer sich wirklich für Demokratie interessiert, fühlt sich inzwischen an den Staatsmann und Rhetoriker Cicero erinnert, den Augenzeugen des Niedergangs der römischen Republik. Deren zunehmend autoritären Charakter und ihr nahendes Ende im Cäsarismus machte er an der Untergrabung der freien, verantwortungsvollen Rede fest, die im Dialog zu gemeinsamen Lösungen führen sollte. Oder bewegen wir uns schon im Feld der Monarchisten?Auch diese – etwa Dante Alighieri in Von der Königsherrschaft – plädierten für eine freie, vernünftige Debatte über Politik und Religion. Selbst der berühmt-berüchtigte Niccolo Machiavelli hatte Lob für die römische Republik; ihr Scheitern schrieb er korrupten Eliten zu, die legitime Kritik unterdrückt hätten. Das Vorgehen gegen Kritik trägt nicht zur Stabilität von Gesellschaftsordnungen bei, sondern gefährdet ebendiese: Erinnern wir uns noch an das, was schon zum Anbruch der frühen Neuzeit die wichtigsten Denker wussten?Die Witterung der ManipulationAber halt: Geht es hier nicht stets um die „verantwortungsvolle“ und „vernünftige“ Rede – wie auch später für die Aufklärer, etwa Immanuel Kant – , während wir heute gegen ganz und gar unvernünftige oder feindlich berechnende Desinformationen und Falschnachrichten antreten? Ganz so einfach ist es nicht. Denn erstens geht es bei dem, was etwa „Faktenchecker“ beschäftigt, oft nicht um simple Sachverhalte, die klar nach richtig und falsch zu sortieren wären, sondern bereits um Interpretationen von Zusammenhängen.Und zweitens fällt auf, wie schnell wir heute die Manipulation in einem Außen oder Unten wittern. Die klassischen Denker wie etwa Jean-Jacques Rousseau – und viel später mit anderem Blick auch Karl Marx – hatten da eher das Oben im Verdacht. In Der Gesellschaftsvertrag beschreibt Rousseau, wie die Mächtigen die öffentliche Meinung steuern, um ihre Herrschaft zu legitimieren. Überhaupt laufe politische Repräsentation Gefahr, in Korruption und Klientelpolitik zu kippen. Solche Skepsis mündete später in das republikanische Prinzip der Gewaltenteilung – oder andere Versuche, eine gewisse Balance in staatlichen Verfassungen zu denken.Am restriktiven Pol steht dabei G.W.F Hegel. In seiner Rechtsphilosophie von 1820 gewährleistet der „sittliche Staat“ Freiheit allein durch Institutionen. Öffentliche Debatte sei nötig, dürfe aber die Ordnung nicht gefährden. Zwar ist dieser Text wohl unter politischem Druck entstanden; anderswo klingt Hegel etwas anders. Doch scheint gerade ein solcher Staatsglaube in der klaglosen Akzeptanz heutiger Diskurs-Eingriffe fortzuwirken, quasi eine Überdosis Hegel à la 1820.Das Verdrängte zulassenAm wichtigsten für die heutige Lage sind aber die Erfahrungen des Faschismus. Zur Weimarer Zeit hatten die lebendige, wenngleich stark polarisierte öffentliche Debatte und ein breites Spektrum politischer Zeitungen denselben nicht stoppen können – und seine erste Maßnahme war die Einschränkung von Meinungs- und Pressefreiheit. Aus dieser Geschichte wurden überaus widersprüchliche Konsequenzen gezogen: Einerseits hielten die Väter und Mütter des Grundgesetzes viel auf das Recht, „seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten“. Doch zugleich entstand die Idee der „wehrhaften Demokratie“, derzufolge Demokratien in gewissem Maße demokratische Rechte einschränken müssen, um deren Missbrauch durch ihre Gegner zu verhindern.Letzterer Ansatz dominiert etwa beim Philosophen Karl Popper. In Die offene Gesellschaft und ihre Feinde formulierte er gleich nach dem Krieg das „Paradoxon der Toleranz“: „Uneingeschränkte Toleranz muss zum Verschwinden der Toleranz führen. Denn wenn wir die uneingeschränkte Toleranz auch gegenüber den Intoleranten“ übten, würden „die Toleranten vernichtet und die Toleranz mit ihnen“. Nicht nur die belgische Politologin Chantal Mouffe weist auf das Paradox im Paradox hin: Ein Staat, der Intolerantz verbietet, rutscht leicht selbst ins Autoritäre.Habermas und die AlgorithmenBis heute wird versucht, weise an dieser Schnittstelle zwischen Freiheit und Kontrolle zu navigieren – nicht zuletzt verschärft durch die Globalisierung der Politik und die Möglichkeiten der Massenbeeinflussung durch die neuen Medien. 1962 nannte Jürgen Habermas in Strukturwandel der Öffentlichkeit die Debatte als Voraussetzung von Demokratie. Wahrheit entstehe im „herrschaftsfreien Diskurs“ – ein Ideal, dem sich Gesellschaften nähern sollten, auch wenn es ein Stück weit utopisch bleibe. 2021 reflektierte er in Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit?, dass dies nicht geschehen ist. Habermas hält gewisse Regulierungen des Diskurses zwar für nötig, warnt aber vor übermäßigen Eingriffen: Unter dem Vorzeichen der „Wahrheitskontrolle“ wachse die Gefahr staatlicher Manipulation. Stattdessen fordert er einen „deliberativen digitalen Raum“ mit transparenten Algorithmen, demokratischer Plattformkontrolle und unabhängigen Medien.Habermas’ Vorschläge leiden indes unter denselben Problemen, welche die Debatte über kritische Öffentlichkeit seit Jahrhunderten prägen. Entscheidungsfindung kann, auch wenn sie im demokratischen Gewand erscheint, durch die Mächtigen beeinflusst sein. So beauftragte die Bundesregierung 2024 ein ‚Bürgergutachten gegen Fakes‘, das zur Kontrolle der Presse Zensurmethoden vorschlug. Der entsprechende Bürgerrat wurde von Innenministerium und vom Verfassungsschutz beraten – und ob die federführende Bertelsmann-Stiftung wirklich gänzlich unabhängig ist, darf man bezweifeln. Und auch die Zivilgesellschaft ist nicht frei von Beeinflussung: Staatliche Förderung kann sie stützen oder durch Gemeinnützigkeitsregelungen verdrängen.Was also tun?Eine mögliche Antwort bietet nicht die Staats- und Demokratietheorie, sondern die Psychotherapie. Carl Gustav Jung, Begründer der analytischen Psychologie, entwickelte das Konzept des „Schattens“ – als Gegenstück zur nach außen sichtbaren Persona umfasse dieser die verdrängten und unterdrückten Eigenschaften des Menschen. Fehlende Auseinandersetzung mit diesen führe zu Zwangshandlungen und gestörten Persönlichkeiten.Überträgt man dies auf den Staat, sind wiederkehrende Fehler und staatszersetzende Tendenzen Symptome mangelnder staatlicher Selbstreflexion. Verdrängt werden nicht nur wirtschaftliche Sorgen, demokratische Defizite und fehlende Repräsentation, sondern auch Teile der eigenen Geschichte, politische Fehlentscheidungen und gesellschaftliche Gewalterfahrungen.Eine stabile gesellschaftliche Ordnung kann nach dieser Analogie nur erreicht werden, wenn es darin Raum für Dissens gibt, wenn also auch unterdrückte und unerwünschte Aspekte der Gesellschaft integriert und anerkannt werden. Das ist leicht gesagt, aber eine komplexe gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die eine einzelne Regierung nur fördern kann. Vor allem aber ist dies ein unabschließbarer Prozess. Aufgabe des Staates ist in dieser Hinsicht das Schaffen von Räumen, in denen solche Prozesse ablaufen können.Das wiederum erinnert an die „herrschaftsfreien“ Diskursräume bei Habermas: wirklich unabhängige Medien, wahrhaft freie Wissenschaft, tatsächlich gleichberechtigter Zugang zu Informationen und Bildung – und zivilgesellschaftliche Akteure, deren Förderung nicht von Opportunität abhängen darf. Dazu aber müssen alle Beteiligten willens sein, auch heftigen – und vielleicht unglücklich artikulierten Dissens auszuhalten. Höchstens dessen Form darf reguliert werden, aber niemals der Inhalt.Das erfordert ein starkes Vertrauen in die Gesellschaft und ein ständiges Hinterfragen von Machtstrukturen. Vor allem aber müsste der Prozess, in dem über die Organisation jener Räume entschieden würde, transparent im Licht der Öffentlichkeit stehen. Die aktuellen Vorstöße der Koalitionspartner und die Entscheidungen vergangener Regierungen liegen freilich weitab von solchen Ideen. Deshalb noch einmal zum Mitschreiben: Nicht Kontrolle schafft Stabilität, sondern Auseinandersetzung. Man weiß das seit Jahrhunderten.