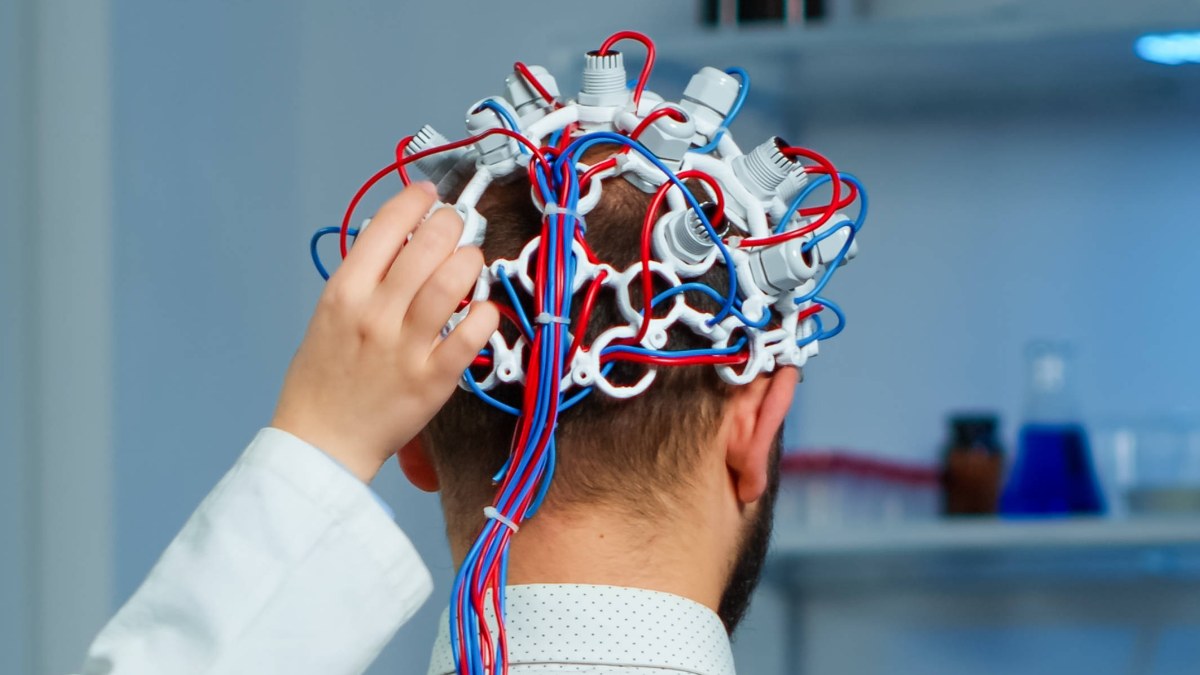In rechten, maskulinistischen Online-Communitys kursiert die „Extreme Male Brain“-Hypothese. Was genau hat es damit auf sich?
Hartnäckig halten sich falsche Behauptungen darüber, wie männliche Gehirne anders ticken
Foto: Imago Images
In der Manosphere, also in rechten, maskulinistischen Online-Communitys, wird Empathie als Hindernis betrachtet, um in einer von Dominanz und Wettbewerb geprägten Welt zu bestehen. Rationalität und Unbarmherzigkeit werden zu Insignien von Stärke und Überlegenheit erklärt, während Empathie als repräsentativ für ein verweichlichtes, feminisiertes Weltbild gilt. So behauptete auch Elon Musk kürzlich im Podcast von Joe Rogan, Empathie sei die „grundlegende Schwäche der westlichen Zivilisation“ und treibe den Westen in den „zivilisatorischen Selbstmord“. Dass Empathie laut der Evolutionsforschung zu den tragenden Säulen menschlicher Zivilisation zählt, spielt offenbar keine Rolle für Musk.
Unter Maskuliniste
u den tragenden Säulen menschlicher Zivilisation zählt, spielt offenbar keine Rolle für Musk.Unter Maskulinisten kursiert stattdessen die „Extreme Male Brain“-Hypothese. Sie besagt, dass Autismus eine extreme Ausprägung des männlichen Gehirns sei. Schließlich zeichne sich Autismus durch eine Tendenz zur Rationalisierung bei einem gleichzeitigen Mangel an Empathie aus – ein extrem klischiertes Bild von Autismus. Der X-Account „Autism Capital“ teilte dementsprechend kürzlich die Vermutung, sowohl Frauen als auch Männer mit wenig Testosteron hätten eine ausgeprägte Empathiefähigkeit als Schutzmechanismus aufgrund ihrer körperlichen Unterlegenheit entwickelt. Ihre Wahrnehmung der Welt sei demnach stets durch einen Konsensfilter geprägt, der dazu führe, dass sie nur das als wahr erachten, was allgemein als wahr akzeptiert wird.Warum wir uns damit befassen sollten? Es ist nur die Spitze eines EisbergsAber zum Glück gibt es, so die Überzeugung, eine kleine Gruppe von Menschen, die objektiv auf die Wirklichkeit blicken können: autistische Männer mit viel Testosteron. Allein ihnen – „those who are free to think“ – sollte daher die Entscheidungsmacht über die Gesellschaft obliegen.Man könnte sich an dieser Stelle fragen, warum man sich mit einer anonymen Hypothese zur Begründung eines faschistoiden Herrschaftsanspruchs, die ohne jeglichen Bezug zu einer wissenschaftlichen Quelle auskommt und von Elon Musk als „interesting observation“ bezeichnet wurde, überhaupt beschäftigen sollte.Ein Grund dafür ist, dass solche Auswüchse sexistischen Denkens lediglich die Spitze eines Eisbergs an Annahmen über vermeintlich „weibliche“ und „männliche“ Eigenschaften darstellen. Extreme Randpositionen sind auch nur radikalere Versionen von weiter verbreiteten Einstellungen. Und die Überzeugung, dass Männer tendenziell rationaler veranlagt seien als Frauen und ihnen damit von Natur aus überlegen, ist wohl eine der konstitutiven Grundüberzeugungen unserer Gesellschaft. Ich musste in meinem Leben jedenfalls schon gegen etliche Variationen dieses tief verankerten Glaubens argumentieren.Der Psychologe Simon Baron-Cohen behauptet, Autismus sei eine extreme Ausprägung „männlichen Denkens“Die „Extreme Male Brain“-Hypothese wurde von dem britischen Psychologen Simon Baron-Cohen bereits um die Jahrtausendwende entwickelt und popularisiert. Sie basiert auf der Annahme, dass es fundamentale Unterschiede zwischen dem „weiblichen“ und dem „männlichen“ Gehirn gebe: Während sich ein idealtypisches männliches Gehirn durch eine Tendenz zur Systematisierung auszeichne, neige ein idealtypisches weibliches Gehirn eher zu Empathie. Autismus, so Baron-Cohen, sei daher eine besonders extreme Ausprägung des „männlichen“ Denkens – und ihre Ursache ein erhöhter Testosteronspiegel der Mutter während der Schwangerschaft.Während Baron-Cohens Studienergebnisse von Anfang an inkonsistent waren, gibt es inzwischen größer angelegte Meta-Studien, die keinen Zusammenhang zwischen dem Testosteronspiegel und der Empathiefähigkeit eines Menschen feststellen konnten. Ebenfalls basiert die Vorstellung, es gebe fundamentale Unterschiede zwischen „weiblichen“ und „männlichen“ Gehirnen, nicht auf haltbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern auf einem alten neurosexistischen Mythos.In The Gendered Brain (2019) zeigt die Neurobiologin Gina Rippon auf, dass viele populäre Behauptungen über geschlechtsspezifische Gehirnunterschiede auf fehlerhaften oder übertriebenen Interpretationen von Forschungsergebnissen beruhen. Die seit Jahrhunderten andauernden Versuche, eine männliche Überlegenheit wissenschaftlich zu belegen, bezeichnet Rippon als eine „history of bias“ – eine Geschichte der Vorurteile. Da eine höhere Intelligenz bis heute nicht nachgewiesen werden konnte, habe sich lediglich der Fokus dieser Bemühungen verlagert: von überlegen zu anders. Eine Realität, in der es keine relevanten Unterschiede zwischen „weiblichen“ und „männlichen“ Gehirnen gibt, scheint für viele immer noch schwer akzeptierbar.Autismus wird häufiger bei Männern diagnostiziert als bei Frauen, was zu falschen Annahmen führtNeben neurosexistischen Annahmen über den Zusammenhang zwischen Geschlecht und Hirnstrukturen spielen auch geschlechtsspezifische Kodierungen von psychischen Krankheiten in den Mythos eines „extrem männlichen Gehirns“. Es gibt bestimmte Krankheitsbilder und Symptome, die historisch entweder weiblich oder männlich konnotiert sind – und die aufgrund dieser Konnotationen oftmals sexistische Denkmuster aufweisen.Man denke nur an die Konstruktion von „Hysterie“ als weiblicher Krankheit, für die bereits in der Antike die Gebärmutter verantwortlich gemacht und die spätestens seit Sigmund Freud auf vermeintliche sexuelle Funktionsstörungen der Frau zurückgeführt wurde. Tatsächlich leitet sich der Begriff sogar direkt vom altgriechischen „hystera“ ab, was nichts anderes als Gebärmutter bedeutet. Auch wenn Hysterie als offizielle Diagnose etwas aus der Mode gekommen ist, hat sich ihr Adjektiv doch bis heute in der Alltagssprache erhalten: Als „hysterisch“ werden fast ausschließlich Frauen bezeichnet.Autismus hingegen wird deutlich häufiger bei Männern diagnostiziert als bei Frauen, was zu der Annahme geführt hat, dass Autismus vor allem ein männliches Phänomen ist. Doch inzwischen weiß man, dass Autismus bei Frauen stark unterdiagnostiziert ist. Dafür gibt es viele Gründe.So beruhte die Autismusforschung lange Zeit auf Studien mit überwiegend männlichen Probanden, was dazu führte, dass die Kriterien für eine Autismusdiagnose an einer typisch männlichen Symptomatik ausgerichtet wurden. Bei Frauen kann sich Autismus jedoch anders äußern. Das ist allerdings weniger auf fundamentale biologische Unterschiede zurückzuführen als auf den Umstand, dass Frauen und Männer mit unterschiedlichen sozialen Erwartungen an ihr Geschlecht aufwachsen und ihr Verhalten entsprechend anpassen.Verhaltensweisen, die mit Autismus in Verbindung gebracht werden, finden bei Jungen und Männern zum Beispiel eher Akzeptanz als bei Mädchen und Frauen, gerade weil sie mit kulturell geprägten Männlichkeitsbildern übereinstimmen – etwa nerdigen Spezialinteressen, einem geringeren Interesse an sozialen Beziehungen, verbunden mit einem Mangel an Empathie. Mit idealtypischen Vorstellungen von „Weiblichkeit“ sind diese Eigenschaften weniger kompatibel. Wenn Mädchen und Frauen sie zeigen, reagiert ihr Umfeld öfter mit Verwunderung oder Ablehnung als bei Jungs und Männern. Sie sind daher stärker darauf angewiesen, ihre Symptome zu kompensieren oder zu verstecken, um soziale Sanktionen zu vermeiden. In der Psychologie nennt man das „maskieren“.Der Effekt einer sich selbst erfüllenden ProphezeiungGanz unrecht hat die „Extreme Male Brain“-Hypothese aber auch nicht. In gewisser Weise stimmt es nämlich, dass die männliche mit der objektiven Perspektive übereinstimmt – und das ist die Ironie an der ganzen Sache. Denn die Objektivität, von der hier die Rede ist, ist nichts anderes als die Subjektivität einer gesellschaftlichen Machtposition, die sich als vermeintlich objektiver Standard durchgesetzt hat – und damit als Maßstab, an dem sich alles andere messen muss.Es ist ganz einfach: Ein zentrales Merkmal von Privilegien ist, die eigenen Privilegien nicht unbedingt zu merken. Je mehr man einer Norm entspricht, desto weniger fällt man auf (und desto weniger fällt einem auf, dass man nicht auffällt). Menschen, deren Perspektiven allerdings von der weißen, cis-männlichen Perspektive abweichen, stellen genau das dar: eine Abweichung. Ihnen wird ein neutraler Blick auf die Welt abgesprochen, da ihr Geschlecht oder ihre Hautfarbe zu einer gewissen Voreingenommenheit führen soll. Aber haben weiße Männer etwa keine Hautfarbe, kein Geschlecht? Sind sie einfach nur Mensch? Oder könnte es sein, dass wir alle durch unser Geschlecht, unsere Hautfarbe und weitere soziale Merkmale beeinflusst werden?Nur weil die weiße männliche Perspektive sich als gesellschaftlicher Standard durchgesetzt hat, bedeutet das nicht, dass weiße Männer einen neutraleren, ungefilterten Blick auf die Welt haben. Es bedeutet vor allem, dass sie die Welt durch die Augen eines weißen Mannes sehen. Damit geht tatsächlich ein gewisser Mangel an Empathie einher – und darin besteht die zweite Wahrheit der „Extreme Male Brain“-Hypothese, die ja behauptet, Männer seien von Natur aus weniger empathisch als Frauen.Man(n) wird nicht unempathisch geboren, sondern Man(n) wird esAllerdings finden sich Argumente dafür, dass dieser Mangel an Empathie nicht auf biologische Bedingungen zurückzuführen ist, sondern auf den Effekt einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Schließlich entwickeln wir uns, in den Worten der US-amerikanischen Autorin Maggie Nelson, in Reaktion auf die Projektionen, die uns entgegenschlagen, zu dem, was wir sind. Und wenn Männern aufgrund von biologistischen Mythen weniger Empathie als Frauen zugeschrieben wird, wird ihr Umfeld auch weniger Empathie von ihnen erwarten, und sie werden infolgedessen weniger Empathie erlernen.Die gute Nachricht ist: Man(n) wird nicht unempathisch geboren, sondern Man(n) wird es. Das Patriarchat bringt unempathische Männer hervor. Und maskulinistische Accounts wie „Autism Capital“ feiern das regelrecht, indem sie Mangel an Empathie als Symptom für eine besonders ausgeprägte Fähigkeit zum rationalen Denken verklären. Figuren wie Musk dienen dabei als ideale Projektionsfläche für Fantasien vom genialen Außenseiter, bei dem soziale Unangepasstheit und emotionale Kälte als Bedingungen für außergewöhnliche Intelligenz geradezu vorausgesetzt werden.Doch wer Rationalität und Empathie gegeneinander ausspielt, hat weder das eine noch das andere verstanden. Ob sie – die Maskulinisten, Baron-Cohens und Musks dieser Welt – wohl irgendwann herausfinden werden, dass man beides sein kann? Empathisch und rational? Dass in der Verbindung dieser Eigenschaften vielleicht sogar die eigentliche intellektuelle Herausforderung besteht?