Ein Gastbeitrag von Thomas Rießinger
Andreas Knie ist nicht nur Soziologe, sondern auch noch Soziologe in Berlin, was die Sache nicht besser macht, und bezeichnet sich als Verkehrsforscher. Für ihn bedeutet das, sich so gut und so oft wie möglich gegen den freien Individualverkehr – sprich: gegen den Gebrauch von Autos, Motorrädern und ähnlichem – auszusprechen. In dieser Eigenschaft hat er der Online-Ausgabe der „Zeit“ ein aufschlussreiches Interview gegeben, das Beachtung verdient.
Schon die Überschrift des „Zeit“-Interviews ist anerkennenswert. „Das Auto schafft viele Freiheiten, manchmal eben auch zu viele“, dürfen wir da lesen, und tatsächlich werden wir diesem Satz im Verlauf des Interviews noch einmal begegnen. Und auch der Aufmacher des Textes entspricht dem Niveau der einstmals ernst zu nehmenden Wochenzeitung: „Der Mobilitätsforscher Andreas Knie sagt, die deutsche Automanie sei schuld an kaputten Straßen, Ehen und Menschen. Die meisten würden sich gern davon befreien.“ Die Straßen sind kaputt, die Menschen sind kaputt, die Ehen sind kaputt, an allem ist das Auto schuld, und die meisten Menschen würden sich gerne von ihm befreien. Warum sie das bisher nicht einfach getan haben, indem sie ihr Auto verkaufen oder sicherheitshalber gleich verschrotten, damit sie keine arme Seele in Versuchung führen, ist nicht unmittelbar klar.
Zu Beginn erklärt uns der Soziologe, die Deutschen führen weniger mit ihrem Auto als noch vor ein paar Jahren und bezieht sich auf die Studie „Mobilität in Deutschland“. Seine Aussage bezieht sich auf die Anzahl der Wege, die jemand hinter sich gebracht hat, es kommt allerdings auch darauf an, über welche Entfernung sich ein solcher Weg erstreckt. Auch darüber erfährt man einiges im Mobilitätsbericht. Zwar liegt der Anteil der mit dem Auto zurückgelegten sogenannten Personenkilometer 2023 bei 73,5% aller Personenkilometer, während sie 2017 – zur Zeit der letzten Studie – bei 74,8% lag, nicht unbedingt ein riesenhafter Sprung nach unten. Was aber den öffentlichen Verkehr betraf, so hat sich sein Anteil zwischen 2017 und 2023 nicht nennenswert verändert, er sank von 18,9% auf 18,8%, was vielleicht nicht für eine qualitative Verbesserung des Angebots spricht. Stark zugenommen dagegen hat der Anteil der zu Fuß zurückgelegten Strecken – kein Wunder, wenn man bedenkt, dass gerade in den Innenstädten die Bürger mit immer höheren Wegelagerergebühren für immer weniger Parkplätze ausgenommen werden.
Knie gibt auch sogleich zu, es handle sich um einen zaghaften „Rückgang auf hohem Niveau. Aber immerhin fangen wir endlich mal an, uns einiger Autos zu entledigen. Das reicht natürlich noch nicht aus. Die Privilegien des Autos, also billiges Fahren und billiges Parken, sind immer noch da. Und viele sagen sich: „Da wäre es ja blöd, wenn ich keins habe.“ Ich musste diese Passage vollständig zitieren, damit sie jeder auf sich wirken lassen kann. Dass wir anfangen, „uns einiger Autos zu entledigen“, sieht man deutlich daran, dass nach Auskunft des Statistischen Bundesamtes die Anzahl der PKWs pro 1.000 Einwohner im Jahr 2024 auf 580 gestiegen ist, während sie 2023 bei 578 lag. Und „die Zahl der hierzulande zugelassenen Autos erreichte zum Jahresbeginn 2024 mit 49,1 Millionen Pkw wie in den Vorjahren erneut einen Höchststand“. So ganz scheint der beschworene Anfang doch noch nicht gelungen zu sein. Doch die Autofahrer können sich freuen, da der Verkehrsforscher sie endlich über ihre Privilegien belehrt, von denen sie bisher vermutlich nichts wussten: Billiges Fahren und billiges Parken hat er diagnostiziert, da kann man nicht klagen. Schade nur, dass die exorbitanten Benzinpreise und die streckenweise mafiösen Parkgebühren eine andere Sprache sprechen, von den Kaufpreisen für Autos will ich gar nicht erst reden.
Wir lernen allerdings auch, wer an diesen vermeintlichen Privilegien schuld ist: „Die Wurzeln reichen bis zum Nationalsozialismus. Schon 1934 wurde entschieden: Lasst uns statt neuer Bahnstrecken doch Autobahnen bauen.“ Ja, es waren wieder einmal die Nazis mit ihrer Fixierung auf Autobahnen, und später ging es munter weiter. „Das Auto wurde Symbol für Freiheit und Wohlstand. Andere Verkehrsmittel spielten praktisch keine Rolle mehr.“ Das Auto wurde unter anderem deshalb ein Symbol für Freiheit und Wohlstand, weil es das Leben erleichterte und freie Mobilität ermöglichte – genau das, was man uns heute nehmen will. Andere Verkehrsmittel können die Leistungen eines Autos nicht ersetzen, vor allem nicht die Möglichkeit, zu jeder beliebigen Zeit von hier nach da zu kommen. So etwas nennt man Freiheit, aber die ist heutzutage ohnehin aus der Mode geraten.
Nach diesem erhellenden historischen Exkurs beklagt sich Knie darüber, dass zu wenig Geld in den Nahverkehr fließe, und benennt auch gleich die Schuldigen: „Die Verantwortung in Politik und Verwaltung des öffentlichen Verkehrs tragen übrigens größtenteils Männer, die selbst Auto fahren.“ Das könnte daran liegen, dass in Deutschland eine überwiegende Mehrheit sowohl der Männer als auch der Frauen sich eines Autos bedient, sonst könnte es wohl kaum 49 Millionen PKWs geben. Aus dieser Banalität eine Kausalität zu konstruieren, ist offenbar hohe Soziologie.
Auf die Suggestivfrage, ob denn die Folgen der „Automanie“ verharmlost worden seien, weiß nun der Verkehrsforscher eine klare Antwort zu geben. „Ja, und viele leiden darunter, nicht nur in den Großstädten. Pendeln kann psychisch krank machen, das zeigen Studien.“ Sicher kann es das, vor allem, wenn man sich mit der Bahn zum Arbeitsplatz begibt in der ständigen Angst, dass der notwenige Zug wieder einmal ausfällt, oder wenn man mit dem Auto an einen Ort fahren muss, wo man grüne Verkehrsbehinderung betreibt mit der Folge höherer Stauzeiten und verstärkter Abgasbelastung. Aber die wichtigste aller Folgen will uns der Soziologe nicht vorenthalten: „Die Pkw-Dichte korreliert gar mit der Scheidungsrate. Je mehr Autos es gibt, desto eher trennen sich Paare. Das Auto hat anfangs die Familie zusammengebracht, dann fuhren alle mit eigenen Fahrzeugen auseinander.“
Jetzt wissen wir’s. Es gibt eine Korrelation zwischen der PKW-Dichte und der Scheidungsrate, und wo eine Korrelation zu finden ist, kann die Kausalität nicht weit sein – man kennt das schon lange, auch zwischen der Anzahl der Störche und der Anzahl der Geburten gibt es eine positive Korrelation. Das Problem ließe sich aber lösen. In manchen Kulturkreisen, deren beste Vertreter sich auch hierzulande immer heimischer fühlen, pflegen Frauen nicht Auto zu fahren, sondern sich in aller Schicklichkeit zu Hause aufzuhalten. Man darf annehmen, dass sich die Scheidungsrate innerhalb dieser Bevölkerungsteile in Grenzen hält. Es ist daher anzuraten, dass sich alle Frauen an diesem Modell orientieren, keine Autos mehr besitzen und das Haus nicht mehr verlassen – sowohl Auto- als auch Scheidungsrate dürften dann deutlich sinken. Ob unser Soziologe dieses Modell vor Augen hat, kann ich nicht wissen, aber seine Folgerung weiß ich: „Das Auto schafft viele Freiheiten, manchmal eben auch zu viele.“ Ja, die Freiheit, sich scheiden zu lassen, ist eine zu viel.
Es versteht sich von selbst, dass auch die sonderbare PCR-Pandemie Erwähnung findet. „Die Coronapandemie“, erklärt er uns, „brachte einen Wendepunkt. Da durften, ja sollten die Leute zu Hause, im Homeoffice bleiben. Und plötzlich merkten viele: Das fühlt sich ja richtig gut an, nicht jeden Tag Auto fahren zu müssen. Das brachte viele zum Umdenken. Homeoffice etablierte sich, und die Autos bleiben öfter stehen.“ Wie war es doch so schön zu Coronazeiten! Die Menschen waren im Homeoffice, die Verkäufer, die Ärzte, die Dachdecker, die Bäcker, und freuten sich, dass sie endlich ihr lästiges Auto stehen lassen konnten. Wenig später stellt der Verkehrsforscher dann fest: „Weil die Leute jetzt aber auch auf dem Land häufiger im Homeoffice bleiben, stellen sie fest: Oh, hier ist ja gar nichts mehr los im Dorf, es gibt keine Geschäfte und keine Ausgehmöglichkeiten. Deshalb wird dort jetzt wieder mehr reaktiviert.“ Solange sie noch mit dem Wagen zur Arbeit fuhren, konnte ihnen das allem Anschein nach nicht auffallen. Üblicherweise pflegt man aber die Besuche von Geschäften und die Nutzung von Ausgehmöglichkeiten in der Freizeit vorzunehmen, und die Freizeit fand bei Dorfbewohnern schon vor den Zeiten des Homeoffice zu nicht geringen Teilen in ihrem Dorf statt. Und da sollen sie es nicht bemerkt haben, dass es an Geschäften und Ausgehmöglichkeiten fehlt?
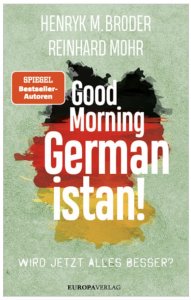
Ich will es nicht übertreiben mit den soziologischen Erkenntnissen; wer das Interview zur Gänze genießen will, kann es gerne lesen. Die angeführten Beispiele sollten die Qualität dokumentiert haben. Natürlich hat der Soziologe noch mehr zu bieten. Die individuelle Mobilität als Inbegriff der Freiheit zu bezeichnen, wie es die CDU in ihrem Grundsatzprogramm getan hat, nennt er gar „skrupellos“, denn das Auto sei „begründungspflichtig geworden, auch für konservative Politiker. Es ist in der schieren Masse nicht mehr selbstverständlich“. Und zwar deshalb, weil ein Soziologe das sagt. Auch ein Projekt in einem Teil Kreuzbergs betrachtet er offenbar als erfolgreich, weil man es geschafft habe, 700 Parkflächen abzuschaffen. „Das Überraschende ist: Das ganze Vorhaben ging bis jetzt fast ohne Klagen über die Bühne. Im nächsten Schritt werden wir sehen, wie viele Anwohner ihr Auto tatsächlich abschaffen.“ Sie wissen es noch nicht einmal, ob auch nur ein einziges Auto abgeschafft wurde, aber Hauptsache, der Bürger wurde wieder ein wenig schikaniert.
Nach all seinen überzeugenden Diagnosen und schlagenden Argumenten hat der Soziologe aber auch Forderungen vorzubringen. „Die Politik darf keine Angst haben, die Privilegien zu streichen, die das Auto hat und die uns alle viel Geld kosten. Allein Pendlerpauschale, Dieselsubventionen und Dienstwagenprivileg kosten laut Umweltbundesamt circa 30 Milliarden Euro – pro Jahr. Die kann man einfach wegnehmen. Ohne Aufschrei. Und man muss sie wegnehmen, weil das Auto längst mehr destruktive Wirkung zeigt als konstruktive.“ Vielleicht sollte die Politik auch einmal über die Privilegien staatlich finanzierter Soziologen nachdenken, deren Streichung ohne Frage zu keinem Aufschrei in der Bevölkerung führen würde. Bei den anderen vermeintlichen „Privilegien“ wäre ich da nicht ganz so sicher. Im Übrigen vergisst der Verkehrsforscher, dass die Pendlerpauschale nicht nur für Autofahrer, sondern auch für alle anderen gilt, vielleicht hat er sich hier zu sehr von Robert Habeck inspirieren lassen, der darüber schon vor Jahren nicht informiert war.
Doch auch jeder Einzelne kann etwas tun, „nämlich weniger Auto fahren“. Jeder könne sich überlegen: „Wofür brauche ich das Auto noch? 90 Prozent aller Wege sind unter zehn Kilometern. Viele sagen jetzt schon: Ein Auto ist bequem, aber eigentlich benötige ich es kaum.“ Wie viele diese „Vielen“ sind, sagt er uns nicht. Ob er als Soziologe regelmäßig Wege bis hin zu 9,9 Kilometern zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegt, verrät er ebenfalls nicht. Und eines wird ihm immer unverständlich bleiben: Das Wesentliche an einem Auto ist nicht, dass man es ständig benutzt, sondern dass man es zu jedem beliebigen Zeitpunkt benutzen kann. Nur das macht freie Mobilität aus, aber man muss befürchten, dass sich das Prinzip der Freiheit in manchen Kreisen keiner Beliebtheit mehr erfreut.
„Es kommt nicht darauf an, was euch passiert, sondern wie ihr darauf reagiert“, sagte der griechische Stoiker Epiktet. Das lässt sich übertragen. Es kommt nicht darauf an, was uns Soziologen erzählen, sondern wie wir darauf reagieren.
Wie immer liegt es an uns.
CDU unterschreibt ihr Ende – Koalitionsvertrag macht sie endgültig zu rot-grünem Erfüllungsgehilfen
„UN-fähig“ in New York: Wie Merz Baerbock peinlich nach oben rettet – und was dahinter steckt
Eine Billion neue Schulden – gesamte Union knickt feige ein! Der Bückling des Jahres vor Rot-Grün
Thomas Rießinger ist promovierter Mathematiker und war Professor für Mathematik und Informatik an der Fachhochschule Frankfurt am Main. Neben einigen Fachbüchern über Mathematik hat er auch Aufsätze zur Philosophie und Geschichte sowie ein Buch zur Unterhaltungsmathematik publiziert.
Bild: Shutterstock
Bitte beachten Sie die aktualisierten Kommentar-Regeln – nachzulesen hier. Insbesondere bitte ich darum, sachlich und zum jeweiligen Thema zu schreiben, und die Kommentarfunktion nicht für Pöbeleien gegen die Kommentar-Regeln zu missbrauchen. Solche Kommentare müssen wir leider löschen – um die Kommentarfunktion für die 99,9 Prozent konstruktiven Kommentatoren offen zu halten.
Mehr von Thomas Rießinger auf reitschuster.de

10-Punkte-Plan zur geistigen Entmündigung der Bevölkerung
Ein harmlos wirkender Auftrag an ChatGPT endet mit einer Diagnose über Deutschlands geistige Verfassung. Zehn Punkte, nüchtern präsentiert – und überraschend frei von ideologischer Tarnung. Von Thomas Rießinger.

Schwarz-Rot regiert am Volk vorbei. In die Sackgasse.
Polit-Erziehung durch Preise, Meinungskontrolle per Gesetz – und dazu ein Kinderlied als Spiegel. Wer noch Hoffnung hatte, wird enttäuscht: Der Merkel-Kurs wird konsequent fortgesetzt. Von Thomas Rießinger.

Der Mann im Knast, der uns befreit
Ein Gefangener, der wegen falscher Worte im Bau sitzt – und ein Publikum, das den Sketch für einen Skandal hält: Hallervorden bringt auf den Punkt, wie tief Satire heute gesunken ist. Doch die Reaktionen zeigen: Es war höchste Zeit.

Aggressive Attacke auf Autofahrer – nach Unfall mit Kind
Ein Kind wird angefahren, kurz darauf versammelt sich eine aggressive Menge, beschädigt das Auto, verletzt einen Beifahrer. Zur Identität der Angreifer kein Wort. Von Thomas Rießinger.

Wenn Freiheit, dann verpflichtend!
Katharina Schulze will einen „verpflichtenden Freiheitsdienst“. Was wie Satire klingt, ist politischer Ernst – und ein Lehrstück in sprachlicher Verdrehung und grüner Doppelmoral. Von Thomas Rießinger.

Änderung des Grundgesetzes: Deutschland schreibt sich um
Ein Sondervermögen mit Verfassungsrang, Klimapolitik als Staatsdoktrin und neue Spielräume für künftige Regierungen. Was bedeutet diese Grundgesetzänderung für Deutschland? Eine Analyse von Thomas Rießinger.

Kanzlerpoker in Berlin: Wer zieht die Strippen hinter den Kulissen?
Schuldenorgien, politische Manöver und ein drohender Linksruck: Welche Strategie die Koalitionäre in spe haben, und warum könnte Merz am Ende leer ausgehen? Ein Blick auf die Machtverhältnisse. Von Thomas Rießinger.







