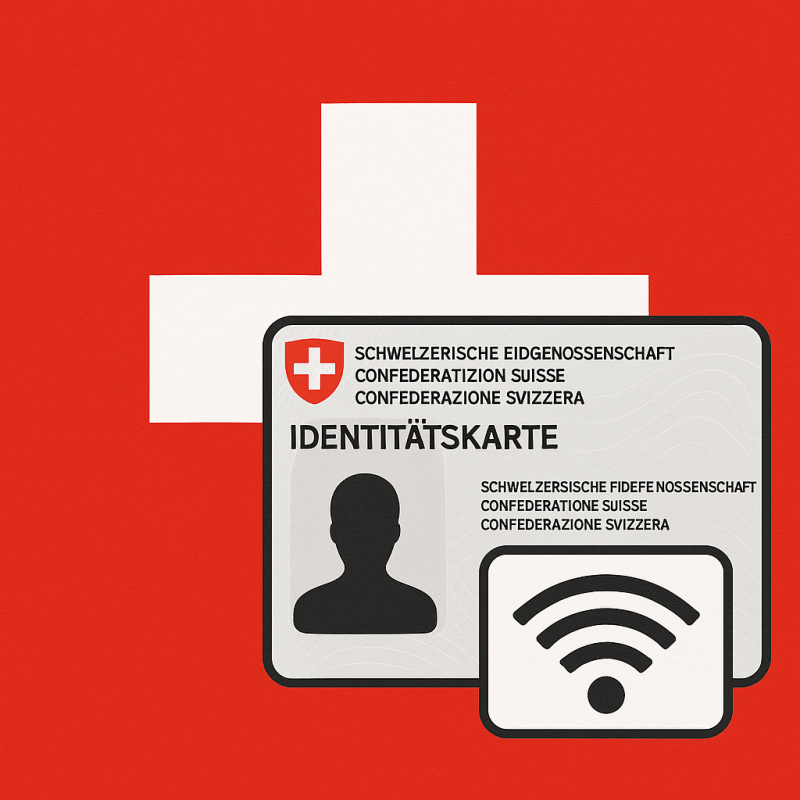Eine Schweizer Petition fordert Social Media erst ab 16 – und ebnet damit womöglich den Weg in ein digital überwachtes Netz
Von Redaktion
Auf der Kampagnenplattform Campax läuft derzeit eine Petition mit dem Titel:
„Schützt unsere Kinder – Likes sind kein Kinderrecht. Social Media erst ab 16“.
Die Forderung: Kinder und Jugendliche sollen gesetzlich vom Zugang zu sozialen Medien ausgeschlossen werden, wenn sie das 16. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Begründet wird dies mit dem Schutz der psychischen Gesundheit, Suchtprävention und sozialer Entwicklung. Unterstützt wird die Petition öffentlich von Nina Fehr Düsel, Nationalrätin der SVP, die das Anliegen kürzlich auf X verbreitete.
Schützt unsere Kinder – Likes sind kein Kinderrecht.
Social Media erst ab 16 Jahren.
Hier kann man unterschreiben.
👇 https://t.co/RiBQDYwG5N— Nina Fehr Düsel (@NinaFehrDuesel) April 24, 2025
Was auf den ersten Blick nach besorgtem Jugendschutz klingt, entpuppt sich bei genauer Betrachtung als Einfallstor für eine tiefgreifende Strukturänderung des freien Internets – mit potenziell autoritären Folgen.
Die Kernforderung
Die Petition verlangt:
- Eine gesetzlich verankerte Altersgrenze von 16 Jahren für soziale Netzwerke wie Instagram, TikTok, YouTube oder Snapchat
- Verpflichtende Altersverifikation auf allen Plattformen durch staatlich definierte Standards
- Eine nationale Strategie für Medienaufklärung und Prävention
Kritik: Was bedeutet das in der Praxis?
1. Jede:r Nutzer:in müsste sich registrieren – mit Ausweis
Eine Altersverifikation funktioniert technisch nur über:
- Hochgeladene Ausweisdokumente
- e-ID-Systeme
- biometrische Verfahren oder Face-Check-Algorithmen
Folge:
Das Internet wird nicht mehr frei zugänglich, sondern ein Kontrollraum mit Ausweispflicht. Wer nicht bereit ist, sich zu identifizieren, wird ausgesperrt – auch Erwachsene.
2. Erziehung wird delegiert – vom Elternhaus zum Staat
Mit einer gesetzlich verordneten Altersgrenze verliert das Elternhaus faktisch die pädagogische Hoheit:
- Der Staat (bzw. Konzerne) übernehmen die Aufsicht
- Eltern dürfen nicht mehr selbst entscheiden, wann ihr Kind ein Video schaut oder chattet
- Ein massiver Eingriff in die Erziehungsfreiheit – unter dem Deckmantel des Schutzes
3. Türöffner für digitale Identitätspflicht im gesamten Netz
Einmal eingeführt, lässt sich diese Infrastruktur leicht ausweiten:
- Kommentarspalten, Foren, Online-Shops, Games – alles denkbar nur noch mit ID
- Kein anonymes Recherchieren, Posten oder Protestieren mehr
- Datenschutz, freie Meinungsäußerung und journalistischer Quellenschutz geraten unter Druck
4. Symbolpolitik statt Medienkompetenz
Die Annahme, Kinder seien automatisch sicherer, nur weil sie keinen Zugang zu TikTok haben, ist illusionär:
- Viele technische Umgehungsmöglichkeiten (VPN, Accounts von Eltern oder Geschwistern)
- Kein Ersatz für echte Medienbildung, kritisches Denken und elterliche Begleitung
- Statt Verantwortung zu fördern, wird sie ausgelagert
Politisches Signal: Wohlmeinender Schutz oder autoritäre Versuchung?
Die Tatsache, dass ausgerechnet eine SVP-Politikerin wie Fehr Düselein den Vorstoß öffentlich stützt, zeigt, dass kinderschützende Rhetorik zunehmend für Kontrollforderungen instrumentalisiert wird – auch im bürgerlich-konservativen Lager.
Was heute mit „Likes sind kein Kinderrecht“ beginnt, kann morgen zur Legitimation für Zensurmechanismen, Meinungskontrolle und Ausschlüsse politisch unliebsamer Stimmen genutzt werden.
Fazit: Schutz als Vorwand für Strukturbruch?
Niemand bestreitet die realen Gefahren digitaler Plattformen für Kinder. Aber die vorgeschlagene Lösung erzeugt mehr Probleme, als sie löst:
- Sie baut eine staatlich-konzerngetriebene Kontrollinfrastruktur auf
- Sie untergräbt Erziehungsfreiheit und digitale Selbstbestimmung
- Sie macht das freie, offene Internet zu einem Lizenzsystem
Wer Kinder schützen will, muss Eltern stärken, nicht sie entmündigen. Und wer Gesellschaft schützen will, muss Freiheit verteidigen – nicht sie systematisch aushöhlen.