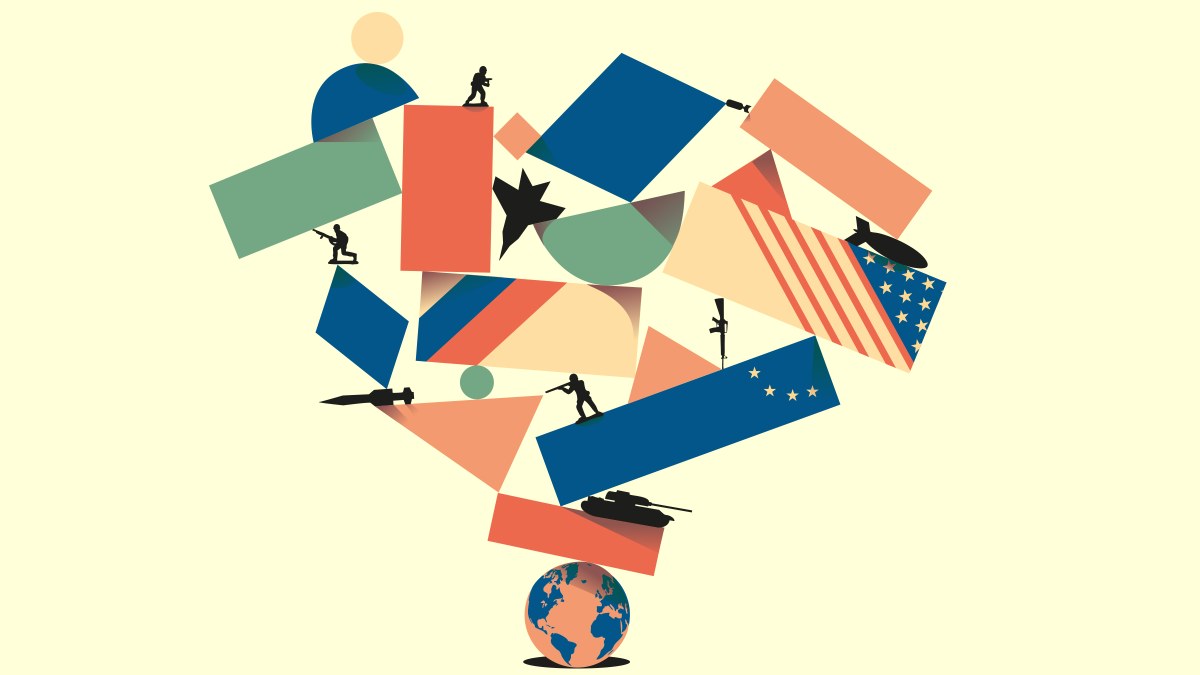Wir brauchen nicht „Kriegstüchtigkeit“, sondern Konfliktkompetenz. Was aber heißt das – gerade am 8. Mai?
Wir befinden uns in einem Wechselbad aus Wunschdenken und Panikattacke
Illustration: der Freitag
Pünktlich zum 80. Jahrestag desjenigen geschichtlichen Wendepunkts, für den sich die seltsam formale Bezeichnung „Kriegsende“ durchzusetzen scheint, ist allenthalben von „Kriegstüchtigkeit“ die Rede. Von einer ganz neuen Haltung, die nötig sei, um dem alten Feind neu zu begegnen. Doch so peinlich es wirkt, wenn Annalena Baerbock als bewundernde Enkelin eines profunden Nazi-Offiziers in diesem Sinne Vertreter des Landes schneidet, das die größten Opfer brachte: Eine „innere Zeitenwende“ ist tatsächlich unausweichlich. Nur anders als zumeist gemeint.
Geht nämlich der Ukraine-Krieg in etwa so aus, wie sich jüngst abzeichnet, zeigt sich darin ein Epochenbruch, auf den man sich tatsächlich einzustellen hät
des schneidet, das die größten Opfer brachte: Eine „innere Zeitenwende“ ist tatsächlich unausweichlich. Nur anders als zumeist gemeint.Geht nämlich der Ukraine-Krieg in etwa so aus, wie sich jüngst abzeichnet, zeigt sich darin ein Epochenbruch, auf den man sich tatsächlich einzustellen hätte. Es entsteht gerade eine Welt, in der sich Staatenkonkurrenz nicht mehr auf das Kraftfeld der einen Hypermacht bezieht, sondern sich in einem komplexen, konfliktiven, stets zu balancierenden System mit mehreren Zentren bewegt. Das seit 35 Jahren gewohnte Mindset passt nicht mehr. Aber was nun? Ersetzen wir „Kriegstüchtigkeit“ durch „Kompetenz zum Navigieren internationaler Konflikte“, zeigen sich Eckpunkte eines adäquaten Mentalitätswandels.NüchternheitOb es nun um eine drohende, latente oder akute Auseinandersetzung geht und ganz abgesehen vom Austragungsmodus sowie dem Grad der eigenen Verwicklung: Vom Küchentisch über die Medien bis in die Politik muss dazu erstens Nüchternheit erlernt werden. Wie weit wir davon entfernt sind, zeigt aktuell das Wechselbad aus Wunschdenken und Panikattacke, mit dem wir auf die Ukraine blicken: Putins „Schrottoffensive“ – so jüngst t-online – pfeift zwar aus dem letzten Loch, doch zugleich droht stets der Durchbruch bis zum Rhein. Diese manische Haltung, die manche schon „Russophrenie“ nennen, behindert vernünftige Entscheidungen.Ständig auszutarieren ist zweitens das Verhältnis von Pluralität und Einmut. Dass auch die kontroversesten Positionen zu einem Konflikt angstfrei vertreten werden können, muss nicht nur möglich sein, sondern gefördert werden: Nur vielstimmige Gesellschaften sind stabil. Gleichwohl ist von der Spitzenpolitik zu fordern, dass weitreichende Fragen – aktuell die nach bestimmten Waffensystemen – nicht etwa nach Parteiprofil entschieden werden, sondern hinsichtlich vernünftigerweise absehbarer Folgen. Das ist schwierig, ja widersprüchlich. Hier muss jene „Verantwortung“ walten, von der man so viel hört.Zu verabschieden ist ferner jenes Denken, das seit 1990 als „Weltinnenpolitik“ firmiert. Illusorisch war die Idee schon immer, man könne internationale Beziehungen ganz wie innerstaatliche verrechtlichen: Es gab zeitweise eine sanktionsfähige Weltpolizei, doch unterstellte sich die nie einer Weltjustiz. Nun aber, da die Polizei den Zugriff verliert, ist der ganze Ansatz obsolet. In Diplomatie wie Alltagsdiskurs muss daraus die Rückkehr zum Prinzip der Nichteinmischung in innere Verhältnisse anderer Staaten folgen, das gegen Ende des unipolaren Moments – 2005 – auf UN-Ebene de facto ausgehebelt wurde.Familiär BeschwiegenesWer es für einen Rückschritt hält, dass ein Staat X einen Staat Y nicht wegen des Umgangs beispielsweise mit einer Minderheit Z sanktionieren sollte, bedenke, wie kontraproduktiv das sein kann: Indem X die Belange von Z in Y zum Gegenstand großer Politik macht, gerät jene Minderheit zu Hause erst recht als „Problem“ in Verdacht, mitunter auf der Ebene von „Staatsräson“. Wohlgemerkt: Es geht hier nicht um Entsolidarisierung, sondern um die Trennung von transnationaler Politik – der Verbindung zwischen Z in X wie Y – und internationalem Regierungshandeln.Und schließlich hängt es auch von uns ab, ob aus Reibung ein Konflikt wird. Man darf nicht hassen. Es ist gefährlich und beschämend zugleich, wenn der designierte neue Außenminister Johann Wadephul gleich mit einer ewigen (!) Feindschaftserklärung an Moskau loslegt. Doch daran ließe sich arbeiten: Seine scheidende Vorgängerin wäre ja nicht allein mit ihrer „Überraschung“ über Opas jüngst aufgetauchte Kriegsakte. Wer weiß denn, wo genau die Ahnen damals waren und was dort geschah? Liegt es nicht nahe, dass etwas Dunkles, familiär Beschwiegenes aus dieser Zeit in unseren Köpfen fortwirkt? So wäre es ein guter Anfang, wenn wir Deutschen nicht mental an eine neue Ostfront drängten, sondern die Archive stürmten.