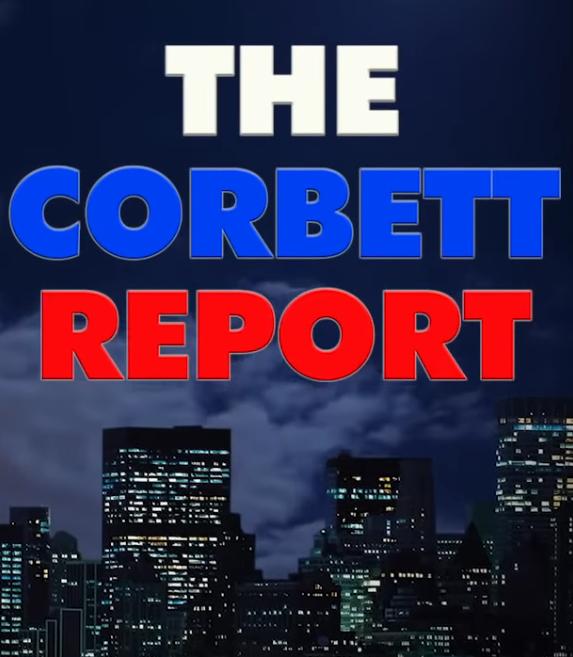In seiner neuesten Podcast-Episode präsentiert James Corbett das Buch „Conspiracy Theory in America“ (2014) des Politikwissenschaftlers Lance DeHaven-Smith als bahnbrechendes Werk, das unser Verständnis von sogenannter „Verschwörungstheorie“ grundlegend verändern sollte. Im Zentrum steht der Begriff „SCAD“ – „State Crimes Against Democracy“ (Staatsverbrechen gegen die Demokratie) – ein neuer analytischer Rahmen für die Betrachtung politischer Verbrechen von innen.
1. Vom Totschlagargument zum Realismus: „Verschwörungstheoretiker“ vs. „Conspiracy Realist“
Corbett beginnt mit der Analyse des Begriffs „Verschwörungstheoretiker“, der seit den 1960er-Jahren gezielt eingesetzt wird, um kritische Stimmen zu delegitimieren. Wer Zweifel an offiziellen Darstellungen äußert, wird in den Bereich des Irrationalen und Paranoiden abgeschoben. Corbett plädiert daher für die Selbstbezeichnung als „conspiracy realist“ – jemand, der realistisch anerkennt, dass politische Verschwörungen historisch belegbar und Teil der Machtpraxis sind.
2. Der Ursprung des Begriffs „Verschwörungstheorie“
Laut DeHaven-Smith wurde der Begriff „conspiracy theory“ erst nach dem Attentat auf John F. Kennedy (JFK) ab 1967 im amerikanischen Sprachgebrauch etabliert, um Kritik an der offiziellen Version der Warren-Kommission zu diskreditieren. Die CIA selbst forcierte diese Begriffsbildung, wie aus dem Dokument „Dispatch 1035-960“ hervorgeht. Ziel war es, kritische Stimmen als irrational, extrem oder staatsfeindlich abzustempeln.
3. Was ist ein SCAD?
Der zentrale Beitrag des Buches ist der Begriff „State Crime Against Democracy“ (SCAD). Damit gemeint sind gezielte Taten oder Unterlassungen durch politische Insider, die demokratische Institutionen untergraben. Beispiele: das JFK-Attentat, 9/11, der Anthrax-Anschlag 2001 oder Wahlmanipulationen. SCADs sind keine Spekulationen, sondern systematische Verbrechen, die im Sinne der Herrschenden begangen und zugleich durch offizielle Untersuchungen vertuscht werden.
4. Die amerikanische Tradition der „Conspiracy Realism“
DeHaven-Smith zeigt, dass die Gründung der USA selbst auf „Verschwörungstheorien“ beruht: Die Unabhängigkeitserklärung spricht von einer gezielten Tyrannei durch die britische Krone. Auch die Federalist Papers und viele frühe amerikanische Politiker verstanden sich als Verteidiger gegen oligarchische Machtkonzentration. Der „Conspiracy Realism“ war einst selbstverständlicher Teil der politischen Kultur.
5. Drei Denkschulen: Beard, Popper, Strauss
DeHaven-Smith kontrastiert drei intellektuelle Strömungen:
- Charles Beard: sah viele historische Entscheidungen als Ergebnis von Eliteinteressen und Übervorteilung der Bevölkerung.
- Karl Popper: kritisierte „Verschwörungsmythen“ als unaufklärbar und irrational.
- Leo Strauss: legitimierte elitenzentrierte „noble Lügen“ als notwendige Grundlage politischer Ordnung.
Corbett warnt davor, dass der Straussianismus aktuell ein Comeback erlebt: Immer mehr Menschen akzeptieren autoritäre Elitenherrschaft als „alternativlos“.
6. Die Wirkung von Memes und Sprache: „9/11“ als programmiertes Narrativ
Ein besonders scharfsinniger Punkt: DeHaven-Smith analysiert, wie sogar Namen und Datumsformate (z. B. „9/11“) bewusst zur psychologischen Rahmung verwendet werden. Dass ausgerechnet diese Zahlenkombination – anders als z. B. „Pearl Harbor“ – im kollektiven Gedächtnis verankert wurde, sei kein Zufall, sondern Ausdruck gezielter semantischer Kontrolle.
7. SCAD statt „Verschwörungstheorie“
DeHaven-Smiths Vorschlag: Statt den Begriff „Verschwörungstheorie“ zu verwenden, sollten wir differenzieren und den Begriff SCAD als konkrete Bezeichnung für Verbrechen aus den Machtzentren heraus nutzen. Das würde die Diskussion entgiften und auf eine rationale, juristisch fundierte Ebene heben.
8. Fazit
James Corbett bewertet Conspiracy Theory in America als Pflichtlektüre für alle, die sich für Medienkritik, politische Philosophie und die Funktionsweise moderner Demokratien interessieren. Das Buch sei ein Gegenmittel zum „paranoiden Stil der Mainstream-Analyse“ und liefere die dringend nötigen Werkzeuge, um politisches Verbrechen im Inneren benennen zu können, ohne in pauschale Abwertung oder Verwirrung zu verfallen.
Empfohlene Lektüre:
- Lance DeHaven-Smith: Conspiracy Theory in America, University of Texas Press, 2014
- CIA-Dokument: Dispatch 1035-960 (1967)
Weitere Informationen:
- corbettreport.com
- archive.org (für kostenlose Buchversion)
„Conspiracy realist“ zu sein, heißt nicht, blind alles zu glauben. Es heißt, die Möglichkeit politischer Verbrechen ernst zu nehmen – vor allem dann, wenn sie von oben kommen.