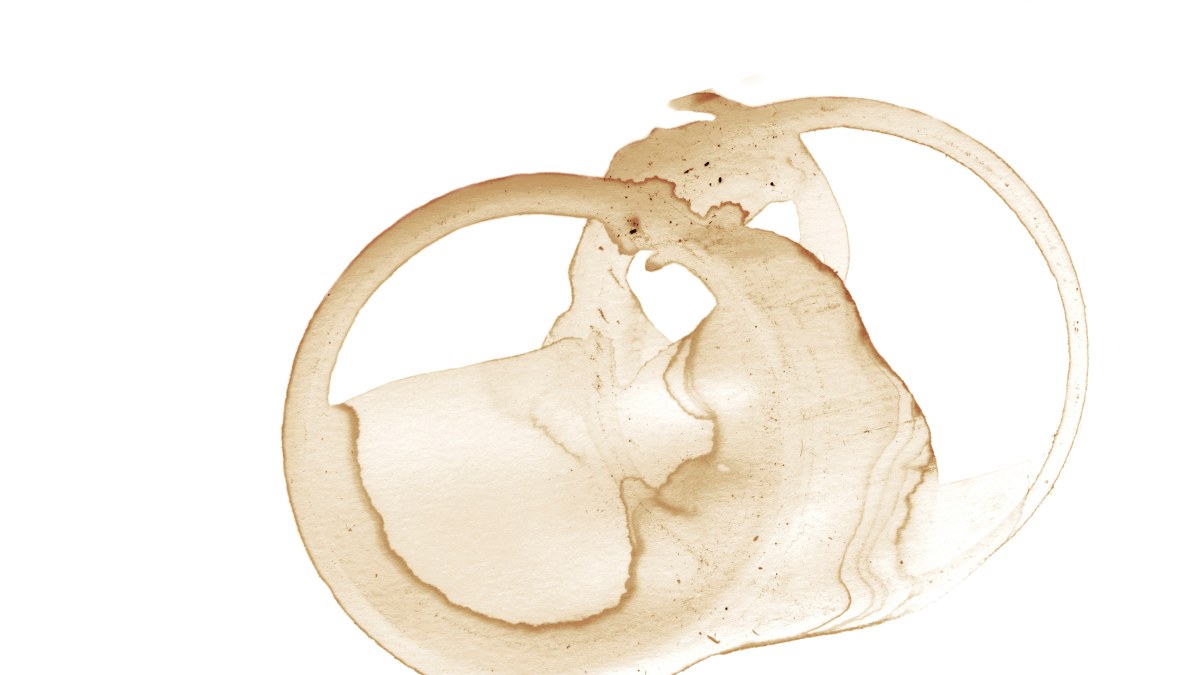A
wie Aufguss
Geboren im Jahr vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs, „noch aus der Kaiserzeit“, wie sie manchmal ironisch sagte, war meine Großmutter so großzügig zu anderen wie gegenüber sich selbst sparsam. Letzteres fiel nicht auf, weil Witz, Offenheit und Gastfreundschaft die protestantische Bauerntochter, die einen dahergelaufenen katholischen Tagelöhner geheiratet hatte, luxuriös umgaben. Nur beim Kaffeekochen wurde die Sparsamkeit kurz sichtbar. Wenn sie beim Sonntagskaffee alle mit handgefiltertem Gebräu bedacht hatte, stellte sie den Filter mit dem bereits gebrühten Einsatz noch einmal auf die leere Kanne zurück und goss heißes Wasser nach, für den „zweiten Aufguss“, wie sie das nannte, was sie sich – und niemals jemand anderem – filterte und in die Tasse gab. Sie lachte und sagte: „Das ist gut für mein schwaches Herz“ (→ Melitta). Ich wünschte, ich hätte nach ihrem Tod den Porzellanfilter an mich genommen, als sichtbare Erinnerung daran, wie man mit Freude streng gegenüber sich selbst sein kann. Beate Tröger
B
wie Blasphemie
Bialetti gehört jetzt den Chinesen? E allora? Na und? Die Italiener kann das nicht schocken, sie trinken weiter ihren Espresso, manchmal auch Cappuccino (aber nur bis 12 Uhr). Hauptsache, keine „Plörre“, wie mir neulich jemand sagte, keine Ahnung, woher der Italiener dieses Wort hatte, aber bei Filterkaffee werden sie drastisch. „Das ist, als würde man Wasser mit Wein mischen, das tötet jeden Geschmack.“ Espresso hingegen: „Effetto bomba“, stark, hat sogar weniger Koffein als Filterkaffee! Und die Cremina! Wird der Espresso mit der achteckigen Mokka gebrüht, dann gibt es zwar keine Crema, aber noch heute wächst jedes Kind in Italien mit dieser Kanne, „la macchinetta“ auf dem Herd auf. Papst Franziskus brach sogar einmal mit dem Protokoll, um spontan in eine Espresso-Bar zu gehen. Dio mio, was, wenn der Barista ihm Filterkaffee serviert hätte? Maxi Leinkauf
D
wie Design
In den 1970er Jahren, da galt Kaffee noch als geistloses Getränk. Designer:innen beschäftigten sich fast auschließlich mit Teegeschirr. Blättert man Designgeschichten von damals durch, findet sich kaum Filterkaffeegerät, dafür jede Menge Tee-Zeug. Auch Filter aus Jenaer Glas, zum Beispiel von Wilhelm Wagenfeld oder Hans Merz. Für das Autorendesign werden Dinge erst dann interessant, wenn man sie zum Medium einer distinktiven Aussage machen kann. Als um die Jahrtausendwende der Barista-Hype begann, als plötzlich Herzchen auf dem Macchiato-Schaum auftauchten und Latte als Kunstwerk verkauft wurde. Der Kaffee war nobilitiert und es gab die schicken Redesigns des Bialetti-Espresso-Kochers (→ Blasphemie). Seit ein paar Jahren ist der ehemals als spießig abgestempelte Filterkaffee dran. Eine stylische Filterkaffeemaschine nach der anderen kommt auf den Markt. Und auch der seit 1938 produzierte Filteraufsatz von Frau → Melitta erscheint dann vielleicht bald in einem coolen Redesign. Michael Suckow
G
wie Gentrifizierung
Einfach bitte einen „normalen Kaffee“, sagt Tom Schilling, Ex-Student, in einer dieser fürchterlichen Berliner Latte-Bars, wo Klischee und Realität so beisammenliegen, dass es wehtut. Im 2012 erschienenen Spielfilmdebüt Oh Boy von Jan-Ole Gerster geht es (unter anderem) um die Schwierigkeit, in Berlin einen schwarzen Filterkaffee zu bekommen. Ein offenbar von morgens bis abends vergebliches Unterfangen, die Suche zieht sich durch den gesamten Film. Und auch die schwäbelnde Barista, gespielt von Katharina Hauck, wird dem Dauerträumer keinen geben, der gentrifizierte „normale Kaffee“ ist sauteuer – und er hat ein paar Cent zu wenig dabei. Obwohl Niko, so ziellos und müde, den Schwung dringend nötig hätte. Die Szene ist, wie der ganze Film, scheinbar komisch, aber darunter liegt Melancholie und ein Abschied vom halbwegs normalen Berlin. Marc Peschke
I
wie Industriebetrieb
Schichtbeginn ist um 6 Uhr. Und um 7 Uhr 30 riecht es nach Filterkaffee. Die Maschine steht im Werkzeugschrank, daneben das Kaffeepulver im abgerissenen Pappkarton. Ein Kollege schaltet die Maschine ein, während der andere noch verschlafen in seinen Becher starrt. Die Kaffeepause gehört in jedem Betrieb dazu. Hier wird gesprochen: über das Spiel vom Wochenende, den Akkuschrauber, die neue Vorgabe vom Meister. Manche trinken lieber Energy. Manche rauchen. Andere schweigen. Die Pause ist geduldet – solange da nichts hochkocht. Wenn der Frust über Taktzeiten, Löhne oder den rauen Umgangston allerdings zu groß wird, dann wird aus der Kaffeepause eine Versammlung. Dann kann sie länger dauern. Dann hört man ganz andere Töne. Dann steht die Produktion still. Der Kaffee wird kalt. Und es wird politisch (→ Zapatisten). Womöglich wird in Deutschlands Industrie noch so manche Kaffeepause in die Länge gezogen, bei 100.000 Arbeitsplätzen, die aktuell in Gefahr sind. Jens Siebers
M
wie Melitta
Mein Vater, Jahrgang 1928, Volksschule, mit 16 vorm Volkssturm im Wald versteckt, wurde später „Maschinenhändler von A–Z“, so stand es auf seiner Visitenkarte. Als solcher kaufte er Konkursware auf, in den 90ern auch im Osten. Von den Versteigerungen brachte er Extravagantes mit, meine Mutter raufte sich darüber die Haare. Hundehütten im kanadischen Stil, Herrenhandtaschen aus Kunstleder oder diese Melitta-Filter aus Alu, die in farblich allmählich verblassender Originalverpackung jahrelang in der Scheune lagerten. Ob sie aus einem Streit der Melitta-Brüder kamen (deren Firmenvergangenheit bekanntlich nicht ohne Naziverstrickung ist), ich weiß es nicht. Mein Vater bestand jedenfalls darauf, dass damit frisch aufgebrühter Kaffee der bekömmlichste sei, posthum kommt er in den Genuss des Rechthabens. Danke, Harvard (→ Studien). Katharina Schmitz
S
wie Studien
Ist Kaffee gesund? Viele Studien, aktuell auch eine der Universität Harvard, sagen: Ja. Mit Kaffee sinke etwa das Risiko, an Diabetes oder manchen Krebsarten zu erkranken oder einen Herzinfarkt zu erleiden. Kaffeetrinker würden auch weniger an Demenz und Alzheimer erkranken. Zudem setze Kaffee Glückshormone frei und könne beim Abnehmen helfen. Allerdings ist die Wirkung abhängig von der Zubereitung: Filterkaffee ist am gesündesten, wer aber Teile vom Kaffeesatz mittrinkt (etwa mit French Press), erhöht seinen Cholesterinspiegel und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hoffentlich schmeckt Ihnen Filterkaffee (→ Blasphemie)! Und für die aufputschende Wirkung müssen Sie die Dosis langfristig erhöhen, weil eine Koffein-Gewöhnung eintritt. Auch die Tageszeit ist wichtig: Wer vormittags Kaffee trinkt, lebt gesünder als Menschen, die gar keinen oder den ganzen Tag Kaffee trinken. Es sei denn, Sie trinken ihn mit viel Milch, Zucker oder Sahne. Bei Menschen mit gewissen genetischen Merkmalen kann Kaffee zudem Stress, Panik und Angstzustände fördern. Ben Mendelson
V
wie Vietnam
Ende der 1970er stieg wegen Ernteausfall der Weltmarktpreis für Kaffee dramatisch. Die DDR-Regierung brauchte Alternativen. Die Bevölkerung lehnte den Ersatzkaffeemix „Erichs Krönung“ ab (→ Westpaket), es kam zur Protestwelle. Die DDR engagierte sich daher für den Kaffeeanbau in Vietnam – im planwirtschaftlichen Austausch gegen Waffen und technisches Gerät. Jedoch benötigen die Pflanzen acht Jahre bis zur Ernte. Erst im Herbst 1989 waren die Bohnen schließlich exportreif. Zu spät für die DDR, aber gut für Vietnam, das dann zum größten Robustaproduzenten der Welt wurde. Dort entwickelte sich eine eigenständige Filterkaffeekultur. Mit dem sogenannten Phin, einem Tassenaufsatz aus Edelstahl, wird der Ca phe sua („brauner Kaffee“) direkt am Tisch zubereitet. Er ist kräftig und wird oft mit gesüßter Kondensmilch getrunken. Tobias Prüwer
W
wie Westpaket
Wie es schon beim Auspacken duftete! „Westkaffee“: Der unsrige dagegen schal. Lag’s an der Röstung, der Verpackung? An der Herkunft der Bohnen, die nach 1945 zunächst über die Sowjetunion importiert wurden und ab 1954 nur auf dem Weltmarkt zu haben waren? Nach Missernten 1975/76 stiegen die Preise. Tauschgeschäfte mit Äthiopien und Angola (später mit → Vietnam) konnten den Bedarf nicht decken. Grundnahrungsmittel waren subventioniert. Kaffee nicht. Der war Luxusgut – Devisen brauchte die DDR-Wirtschaft für Wichtigeres. Mangel erhöhte die Nachfrage. 3,6 Kilogramm Bohnenkaffee pro Kopf und Jahr wurden in den 1970er Jahren konsumiert. 3,3 Milliarden Mark gaben DDR-Bürger dafür aus. Für die billigste Sorte „Kosta“ mussten sie 7 Mark 50 berappen, pro 125 Gramm. „Rondo“ und „Mona“ waren teurer. „Kaffee-Mix“ für 4 Mark, der zu 49 Prozent aus Surrogaten bestand, wurde von den meisten als „Muckefuck“ verschmäht. Pakete mit Jacobs Krönung, Fernsehwerbung, Intershops – die westliche Warenwelt triumphierte, noch ehe die DDR zerbrach. Irmtraud Gutschke
Z
wie Zapatisten
Die beste Zutat für deine Tasse Filterkaffee? Eine kräftige Brise Würde! So – oder so ähnlich – würden es wohl die Zapatist*innen selbst sagen (→ Industriebetrieb). Die indigene Bewegung im Süden Mexikos kämpft seit ihrem Aufstand 1994 für Autonomie, Gerechtigkeit und ein Leben jenseits des Kapitalismus. Auslöser war das Inkrafttreten des Freihandelsabkommens NAFTA, das die Kleinbäuerinnen in Konkurrenz mit US-Großkonzernen brachte und ihre Existenz bedrohte. Heute bauen sie in selbst verwalteten Kooperativen Hochland-Arabica an – ökologisch, selbstbestimmt und gemeinwohlorientiert. Er ist auch in Deutschland über solidarische Netzwerke erhältlich. Und der Schluck Soli-Kaffee am Frühstückstisch? Der stärkt nicht nur die zapatistische Unabhängigkeit – sondern bringt auch eine Portion Rebellion in deinen Alltag. Sebastian Bähr