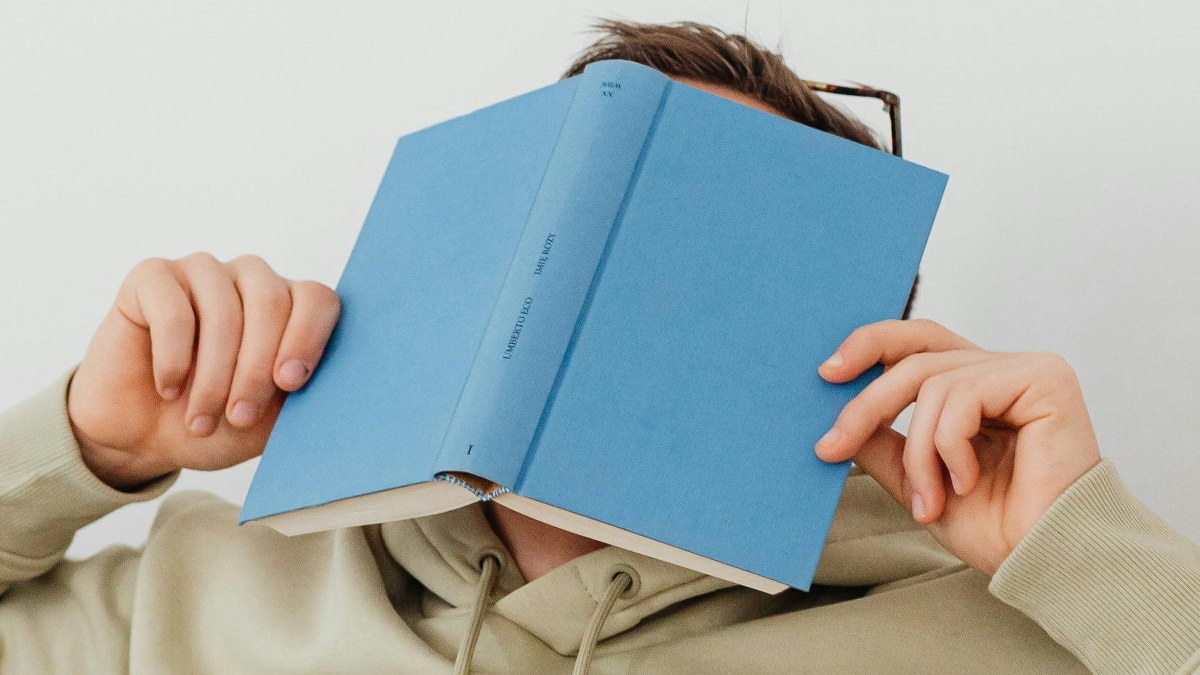Beim Anblick der Schullektüre ihres Sohnes, fragt sich unsere Autorin, was der Fetisch fürs Drama als Abi-Lektüre soll. Warum quält man Generationen von Schüler*innen mit Kleist, Fontane und Mann?
Langeweile, Wut gegenüber der Schule, der Moment der Karthasis
Foto: Pexels
Daheim wiederholt sich derzeit ein klassisches Drama: Allmählich aufsteigende Handlung bis zur Klimax, dem Höhepunkt. Der Sohn schlenzt sich durch die berüchtigte Lebensphase Pubertät, seine Mutter wurstelt sich durch die nicht minder gefürchtete Menopause. Es kommt zu Kollisionen. Wäre unser einziger, unfreiwilliger Zuschauer nicht der entnervte Bruder/Sohn, sondern ein entnervter Theaterkritiker, würde er die Dramen wegen der Kürze als explosive Dramolette beschreiben – bis eine/r abgeht.
Die österreichische 60er-Jahre-Dramatiker-Legende Wolfgang Bauer soll dafür den Begriff des Mikrodramas erfunden haben. Basta!, ein 1983 gegründetes, 1994 eingestelltes Magazin schrieb über ihn: Er „provoziert auf der Höhe der Zeit: (…) Bildungsgut, Tüchtigkeit und kulturelles Erbe verzerren sich zum irrwitzigen Panoptikum.“ Seine Themen scheinen manchem zu ähneln, was bei uns durchgängig zur Aufführung kommt. Es geht um Bildungsansprüche an das Kind oder anschwellend um die Frage: Wer steht wem oder sich selbst im Weg.
Klassisch auch: Immer wieder versucht die Hauptfigur, Hindernisse zu bewältigen. Es sind die retardierenden Momente im Drama, die Spannung erzeugen sollen. Die Mutter ist zum Beispiel immer noch gespannt, ob das Kind an der Schule doch noch Gas gibt.
Neulich wieder Hoffnung. Der Sohn betrat beunruhigt, ja rastlos die Küche, er habe einen seltsamen Traum gehabt. Geträumt, für den Deutschunterricht Heinrich von Kleists Zerbrochenen Krug bereits bei Amazon bestellt zu haben. „Habe ich?“ Sogar zweimal, inklusive Lektürehilfe.
Die Mutter kennt von Kleist halbwegs die Prosa, der wütende Michael Kohlhaas bot ihr einmal durchaus Identifikationspotenzial. Ihr Versuch, den Sohn für den Autor zu interessieren, geriet trotzdem äußerst fragwürdig: „Kleist hat sich mit seiner Freundin Henriette umgebracht“. Das Kind quälte sich also und befand nach der Lektüre: „Total langweilig! Habe ich auch so der Deutschlehrerin an den Kopf geworfen!“
Langeweile, Wut gegenüber der Lehrerin, unser Moment der Karthasis: Dramen zu lesen ist wirklich total langweilig, mein Sohn! Aber, warum nur? Und woher die Rage?
Fragt man den Literaturwissenschaftler Johannes Franzen, Autor des sehr selbsterkenntnisreichen Buches Wut und Wertung – Warum wir über Geschmack streiten (S. Fischer 2024), lernt man: Es gibt eine lange Tradition, Schullektüre als Inbegriff einer Pflichtrezeption wahrzunehmen. Heinrich Mann habe das am Beispiel von Schillers Jungfrau von Orleans schon vor 100 Jahren im Professor Unrat beschrieben. Kleists sperriges Meisterwerk könnte, ähnlich wie Theodor Fontanes Effi Briest, eine ganze Generation von Schülerinnen ins Internet treiben, „wo sie hasserfüllte Rezensionen schreiben werden, um sich für die erzwungene Rezeption zu rächen“. Das Stück sei sehr voraussetzungsreich, gerade Humor übersetze sich ausgesprochen schlecht, wirke 200 Jahre später höchst rätselhaft auf die Rezipienten. „Dramen, die ja nicht zum Lesen, sondern für die Bühne geschrieben wurden, eignen sich nur schlecht, um den Wert und Zauber von Literatur zu vermitteln.“
Was soll also der Fetisch fürs Drama im Rahmenlehrplan Abitur? Stecken dahinter Bildungsphilister, die selbst schon lange verloren sind für die Literatur? Die Mutter arbeitet sich jedenfalls am Krug jetzt vorsichtshalber auch noch ab, einzig, weil sie öfter noch albträumt, durchs Abitur gefallen zu sein.