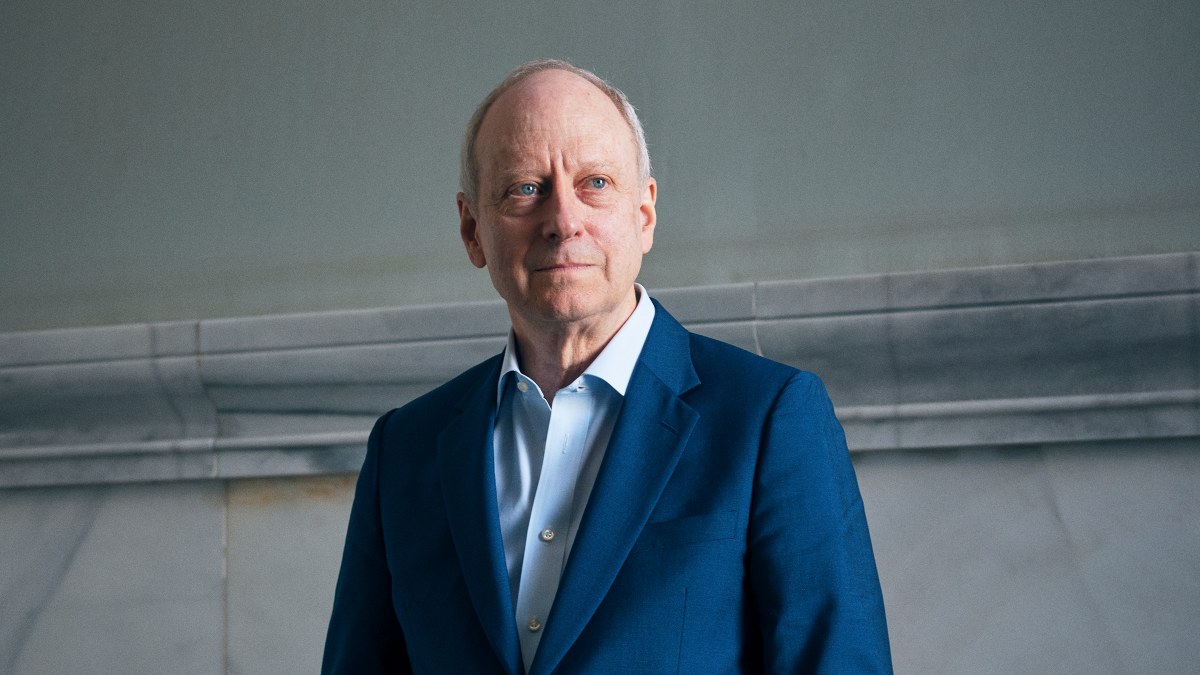Der Harvard-Professor Michael Sandel weiß, warum die Demokraten in den USA schon wieder gegen Donald Trump verloren haben: Weltweit habe die Linke keine Antwort auf das menschliche Bedürfnis nach Gemeinschaft – die autoritäre Rechte schon
„Die Linke spricht oft von Inklusion, schafft es aber selten, ein Gefühl von Zusammenhalt zu vermitteln“, sagt Michael Sandel
Foto: Jacobo Medrano
Mit seinen Vorträgen füllt Michael Sandel nicht nur Säle in Harvard, sondern auch das Operhaus in Sydney oder die St. Paul’s Cathedral in London. Weit über die USA hinaus begeistert er ein Millionenpublikum, Olaf Scholz (SPD) lud den Moralphilosophen im Dezember 2020 zu einer Videokonferenz ins Willy-Brand-Haus ein. Der Bundeskanzler, damals noch Finanzminister, sprach mit Sandel über dessen Buch Vom Ende des Gemeinwohls – Wie die Leistungsgesellschaft unsere Demokratien zerreißt (den Talk kann man sich hier noch ansehen).
Wie stark Scholz von dem Amerikaner beeinflusst wurde, ist schwer zu sagen. Aber eines ist klar: Michael Sandel liefert eine schlüssige Antwort auf die Frage, warum die Linke im Wettbewerb mit den Rechten so sehr an Boden ver
üssige Antwort auf die Frage, warum die Linke im Wettbewerb mit den Rechten so sehr an Boden verliert. Zuletzt war das zu beobachten, als Kamala Harris bei der US-Wahl gegen Donald Trump den Kürzeren zog. Wie guckt Sandel auf Trumps Amtszeit 2.0.? der Freitag: Herr Sandel, wie fühlen Sie sich seit dem 5. November?Michael Sandel: Ich bin enttäuscht, aber nicht überrascht. Trumps Sieg hat erneut gezeigt, wie schwer es der Demokratischen Partei fällt, den Kontakt zur klassischen Arbeiterschaft wiederherzustellen. Über Jahre hinweg hat sich die Partei von Arbeitern ohne akademischen Abschluss entfremdet und ein Weltbild sowie ein Selbstverständnis entwickelt, das eher bei der akademischen Elite Anklang findet. Dieser Trend war auch bei dieser Wahl sichtbar – und Trump hat ihn geschickt für sich genutzt. Dass es den Demokraten nicht gelingt, dieses Bild zu korrigieren und die Sorgen sowie die Hoffnungen der Arbeiterklasse ernsthaft anzusprechen, verweist auf eine tiefere politische und kulturelle Kluft.Haben Sie mit einem derart eindeutigen Ergebnis gerechnet?Nun, Trump erreichte nur knapp 50 Prozent der Stimmen, doch das Wahlsystem des Electoral College hat seinen Erfolg überproportional verstärkt. In den umkämpften Bundesstaaten hat er Kamala Harris knapp geschlagen, wodurch der Sieg deutlicher wirkt, als er tatsächlich war. Das zeigt, dass das System knappe Siege zu scheinbar klaren Erfolgen aufbläht.Wird seine zweite Präsidentschaft Auswirkungen auf die Hochschulen haben?Das ist durchaus möglich. Donald Trump kritisiert Universitäten seit Jahren als Zentren einer vermeintlich „woken“ Kultur und als elitär und abgehoben. In seiner ersten Amtszeit blieb das meist bei Worten, aber diesmal könnte er tatsächlich konkretere Maßnahmen ergreifen, etwa die Besteuerung der universitären Stiftungsvermögen. Die Angriffe auf Hochschulen passen zu seiner breiteren Strategie, die Demokraten und ihre Institutionen als abgehobene Eliten darzustellen, die nichts mit den alltäglichen Sorgen der Menschen zu tun haben. Dieses Anti-Eliten-Narrativ funktioniert, weil es tiefere Probleme wie soziale Ungleichheit und die Schattenseiten der Meritokratie anspricht – auch wenn seine Kritik natürlich oft selektiv und zynisch ist.Die Finanzkrise 2008 verstärkte das Gefühl der Menschen, dass das System zugunsten der Mächtigen manipuliert istIn Ihrem Buch „Das Unbehagen in der Demokratie“, das in den 1990er Jahren erstmals veröffentlicht wurde und im vergangenen Jahr als Neuauflage erschien, lieferten Sie eine Gegenposition zu Fukuyamas Theorie vom Ende der Geschichte. Während Fukuyama den Sieg der liberalen Demokratie als endgültig ansah, warnten Sie vor wachsenden Spannungen. Wie kamen Sie zu dieser Einschätzung?Fukuyama spiegelte die Euphorie der 1990er Jahre wider – den Glauben, dass die liberale Demokratie endgültig gesiegt habe und es keine ideologischen Konflikte mehr geben würde. Doch ich sah die Dinge anders. Hinter dieser triumphalen Fassade gab es beunruhigende Entwicklungen: Viele Bürger fühlten sich entmachtet, weil Entscheidungen zunehmend von Technokraten und nicht von gewählten Vertretern getroffen wurden. Gleichzeitig erodierte die Globalisierung die Bindungen an lokale Gemeinschaften, während nationale Identität als überholt galt. Ich war der Meinung, dass diese Entwicklungen unweigerlich eine Gegenreaktion hervorrufen würden. Diese Gegenreaktion hat sich dann in Form von Trump und ähnlichen Bewegungen manifestiert, die auf Souveränität und kulturelle Rückbesinnung setzen.Welche historischen Ereignisse waren denn entscheidend für diese Gegenreaktion?Die Finanzkrise von 2008 war ein Wendepunkt. Die Art und Weise, wie die Krise bewältigt wurde – die Rettung von Banken, während viele Hausbesitzer ihrem Schicksal überlassen wurden – verstärkte das Gefühl, dass das System zugunsten der Mächtigen manipuliert ist. Das hat die Wut der Menschen angefacht und die Gegenbewegung beschleunigt. Auf der linken Seite führte dies zu Bewegungen wie Occupy Wall Street und Bernie Sanders. Auf der rechten Seite befeuerte es die Tea Party und mündete schließlich in Trumps Wahlsieg. Auch wenn ich die Krise selbst nicht vorhersehen konnte, habe ich doch die Muster erkannt, die solche Entwicklungen begünstigt haben: das wachsende Gefühl der Machtlosigkeit und der Verlust von Gemeinschaft. Diese Frustrationen sind nachhaltiger, als viele vermutet haben.Joe Biden hat versucht, neoliberale Politiken zurückzudrängen. Warum hatte das nicht mehr politischen Erfolg?Bidens Werdegang spielte für seine Politik eine wichtige Rolle. Er war der erste demokratische Präsidentschaftskandidat seit 36 Jahren ohne Ivy-League-Abschluss. Dadurch war er weniger empfänglich für die meritokratischen Vorstellungen der Ökonomen, als es etwa bei Bill Clinton oder Barack Obama der Fall war. Politisch hat Biden viel erreicht: Seine Regierung investierte in Infrastruktur, förderte die heimische Industrie und ging gegen die Marktkonzentration großer Konzerne vor. Die Beibehaltung von Trumps Zöllen auf China zeigte ebenfalls einen deutlichen Bruch mit der bisherigen Freihandelspolitik. Aber die Politik Bidens war ja auch nicht das Problem.Politische Maßnahmen brauchen ein Narrativ. Joe Biden fehlte solch eine verbindende GeschichteSondern?Biden gelang es nicht, eine klare Vision zu formulieren. Politische Maßnahmen, so wichtig sie auch sind, brauchen ein Narrativ, das sie miteinander verbindet und ihre Bedeutung erklärt. Franklin Delano Roosevelt hat den New Deal nicht nur umgesetzt – er hat ihn als neues Verhältnis zwischen Staat und Bürgern verstanden. Biden fehlte ein solches Narrativ, und ohne diese verbindende Geschichte blieben selbst große Erfolge in der öffentlichen Wahrnehmung blass.Konnte denn Trump ein solches Narrativ liefern?Trumps Stärke liegt nicht in der Politik, sondern in der Rhetorik. Slogans wie „Make America Great Again“ oder „America First“ sprechen das Bedürfnis der Menschen nach Zugehörigkeit und Kontrolle an. Doch seine Bilanz zeigt, dass er wenig für die Arbeiterschaft getan hat, die ihn gewählt hat. Sein wichtigstes Gesetz war eine Steuerreform, die vor allem Unternehmen und Wohlhabenden zugutekam. Auch versuchte er, Obamacare abzuschaffen, auf das viele seiner Wähler angewiesen sind. Trump ist ein Meister im Schüren von Emotionen, aber seine Politik bleibt oft substanzlos.Manche sagen, dass die Arbeiterschaft irrational handelt, wenn sie politische Anführer wie Donald Trump unterstützt.Diese Sichtweise verkennt, was die Menschen antreibt. Es geht nicht nur um wirtschaftliche Sorgen, auch wenn diese eine Rolle spielen. Das größere Thema ist kultureller Natur. Die meritokratische Elite feiert akademische und wirtschaftliche Erfolge oft als völlig gerechtfertigt und verdient, was bei Menschen ohne Universitätsabschluss für Unmut sorgt. Das schafft eine Spaltung zwischen Gewinnern und Verlierern, die tiefer geht als wirtschaftliche Ungleichheit. Viele Arbeiter fühlen sich respektlos behandelt, und Trump greift genau dieses Gefühl auf, auch wenn seine Politik ihre materiellen Probleme nicht löst.Seit Jahrzehnten haben Mitte-Links-Parteien das Feld des Patriotismus der Rechten überlassen, weil sie ihn mit Nationalismus oder Fremdenfeindlichkeit gleichsetzenWarum wird diese kulturelle Dimension der Spaltung in der öffentlichen Debatte nur so selten thematisiert?Viele Progressive kommen selbst aus elitären Kreisen und tun sich schwer damit, ihre eigene Rolle in dieser Spaltung zu reflektieren. Die Fehler neoliberaler Politik zuzugeben und die Arroganz, die in meritokratischen Einstellungen mitschwingt, nüchtern wahrzunehmen, würde bedeuten, die eigene Verantwortung für die gegenwärtige Situation anzuerkennen. Das ist eine unbequeme Einsicht für diejenigen, die von diesem System profitieren.Sie plädieren für eine linke Form von Patriotismus. Warum ist das wichtig?Eine soziale Demokratie lebt von Solidarität, und diese setzt ein Gefühl nationaler Gemeinschaft voraus. Seit Jahrzehnten haben Mitte-Links-Parteien das Feld des Patriotismus der Rechten überlassen, weil sie ihn mit Nationalismus oder Fremdenfeindlichkeit gleichsetzen. Das war ein Fehler. Menschen sehnen sich nach Gemeinschaft und Zugehörigkeit, und Progressive müssen Patriotismus als Teil ihrer Vision zurückgewinnen. Zum Beispiel: Wenn Konzerne Steueroasen nutzen, ist das nicht nur ein finanzielles Problem – es ist ein Verrat an wirtschaftlichem Patriotismus. Wenn man solche Themen in den Kontext gemeinsamer Verpflichtungen stellt, bietet das eine überzeugende Alternative zur ausgrenzenden Rhetorik der Rechten.Wie trägt das zu einer Erneuerung der Demokratie bei?Demokratische Erneuerung braucht sowohl ein wirtschaftliches Programm, das Würde und Arbeit ernst nimmt, als auch eine kulturelle Vision, die die Bürgerinnen und Bürger miteinander verbindet. Die Linke spricht oft von Inklusion, schafft es aber selten, ein Gefühl von Zusammenhalt zu vermitteln. Ein Patriotismus, der mit Werten wie Solidarität und Gerechtigkeit verknüpft ist, kann dabei helfen, diese Lücke zu adressieren. Es geht darum, eine Erzählung zu schaffen, die den Wunsch nach Einheit anspricht und die gemeinsamen Verpflichtungen als Bürger betont. Das ist entscheidend, um die Demokratie zu stärken.Sind Sie zuversichtlich, dass diese Erneuerung gelingt?Das liegt an uns. Die Geschichte endet nicht – sie fordert uns heraus, uns anzupassen. Der autoritäre rechte Flügel ist eine Bedrohung für die Demokratie, keine Frage. Aber diese Zeit bietet auch eine Chance. Progressive müssen die Gelegenheit nutzen, um das gemeinsame zivile Leben neu zu definieren. Es geht um die Würde der Arbeit, die Bedeutung von Gemeinschaft und die Verpflichtungen, die wir uns einander schulden.