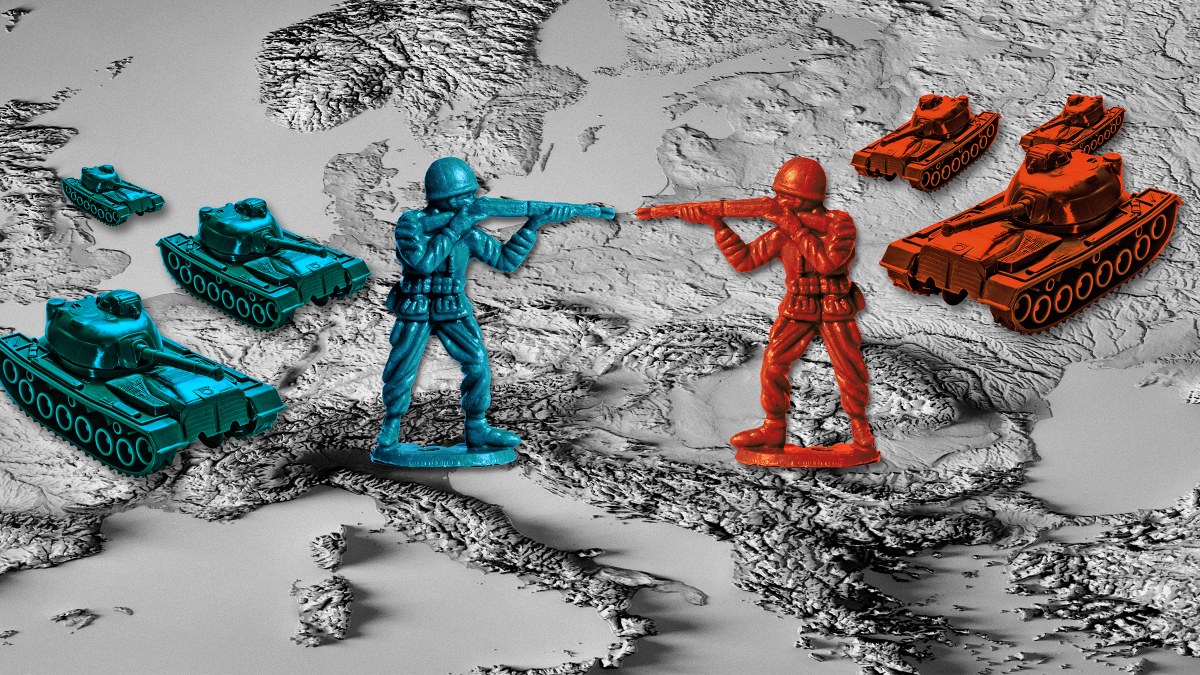Entstanden als Rechtfertigung für Großmachtstreben, ist die einst verpönte „Geopolitik“ wegen Trumps Neuordnung der Welt heute wieder en vogue. Warnung vor einer verhängnisvollen Denkschule
Der zum Staatsmann gereifte Alt-Grüne Daniel Cohn-Bendit (79) sagte im Juni 2024 in der Talkshow Maischberger den denkwürdigen Satz: „Europa kann untergehen, wenn wir uns geopolitisch nicht anders organisieren.“ Da lag die Wiederwahl Donald Trumps zum US-Präsidenten noch in ferner Zukunft. Doch seitdem der unberechenbare Wüterich erneut im Oval Office sitzt und die regelbasierte Weltordnung des Westens zertrümmert, befinden sich Europas Eliten in heller Aufregung. Sogar Teile der Linken glauben, sich den „geopolitischen Machtfragen“ nicht länger entziehen zu können.
Sie alle wollen weg vom Klein-Klein einer ängstlichen Ohr-am-Volk-Politik und wieder groß und strategisch denken. Sie wollen „Weltpolitik“ machen.
Westens zertrümmert, befinden sich Europas Eliten in heller Aufregung. Sogar Teile der Linken glauben, sich den „geopolitischen Machtfragen“ nicht länger entziehen zu können.Sie alle wollen weg vom Klein-Klein einer ängstlichen Ohr-am-Volk-Politik und wieder groß und strategisch denken. Sie wollen „Weltpolitik“ machen. Die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen, die aufstrebenden Außenpolitiker der europäischen Mitte-Parteien, viele Thinktank-Experten, Politikprofessoren, Generäle und Leitartikler reden heute so selbstverständlich über „Geopolitik“, als hätten sie nie ein anderes Thema gekannt. Josep Borrell, bis 2024 Chefdiplomat der EU-Kommission, nannte den Krieg in der Ukraine gar „die Geburtsstunde des geopolitischen Europas“. Und die Konrad-Adenauer-Stiftung erklärte stolz: „Geopolitik ist zu einem Hauptfach geworden.“Doch woher kommt dieser merkwürdige Begriff, wann wurde er geprägt, was wurde mit ihm bezweckt? Wer hat Geopolitik als erstes propagiert und welche außenpolitischen Strategien basieren auf ihren Gedanken? Es ist noch gar nicht so lange her, da war Geopolitik als Gegenstand politikwissenschaftlicher Analyse verpönt, ein für alle Mal verbrannt durch politische Instrumentalisierung vor und während der beiden Weltkriege. Die Protagonisten der Geopolitik galten als willige Helfer einer skrupellosen, „raumgreifenden“ Machtpolitik. Mit Hilfe ihrer „Theorien“ wurden imperialistische Raubzüge und die Versklavung anderer Völker gerechtfertigt.Ihre pseudowissenschaftlichen Ansichten waren der modernen Politikwissenschaft, die sich mit internationalen Beziehungen, mit völkerrechtlichen Fragestellungen und den daraus abzuleitenden institutionellen Verfahren befasste, so zuwider, dass Geopolitik nach dem Zweiten Weltkrieg – zumindest in Deutschland – aus den parteipolitischen und wissenschaftlichen Diskursen fast völlig verschwand. Nur einige „unbelehrbare“ Randfiguren wie Heinz Brill hielten den Begriff in den Lehrplänen der Führungsakademie der Bundeswehr mühsam über Wasser. Und heute? Heute sehen wir eine inflationär anwachsende Wiederverwendung dieses antiquierten Begriffs, ohne dass dessen Nutzer auch nur im Entferntesten darüber Rechenschaft ablegen würden, in welch unheilvoller Tradition sie sich bewegen. Für die meisten ist Geopolitik bloß ein anderes Wort für Außenpolitik, doch ursprünglich entstand die Disziplin im 19. Jahrhundert als Legitimationswissenschaft für die Ziele imperialistischer Großmachtpolitik.Placeholder image-5Von Anfang an konkurrierten dabei die mitteleuropäischen Expansionsträume der großen Landmächte (Deutschland, Frankreich, Russland) mit dem angelsächsischen Vorherrschaftsstreben der dominierenden Seemächte (Großbritannien, USA). Geopolitik als Methode der Außenpolitikanalyse wurde daher nicht zufällig genau in dem Moment geboren, als die Großmächte begannen, sich ein Wettrennen um Rohstoffe und Kolonialbesitz in Afrika und Asien zu liefern, und das Thema „Weltherrschaft und ihre Voraussetzungen“ in den Köpfen politisierender Intellektueller konkrete Gestalt annahm.!—- Parallax text ends here —-!In Mitteleuropa ist das Entstehen der geopolitischen Denkschule untrennbar mit dem Namen Friedrich Ratzel (1844 – 1904) verbunden. Der in Karlsruhe geborene, später in München und Leipzig lehrende Zoologe und Geograf gilt als der entscheidende Wegbereiter der „politischen Geografie“. Ratzel verschmolz den in seiner Zeit populären Darwinismus mit den akademischen „Altfächern“ Geschichte, Geografie und Staatswissenschaften. Sein 1897 erschienenes Hauptwerk Politische Geographie betrachtet den Staat als biologischen „Organismus“. Und da Organismen, um überleben zu können, wachsen müssen, leitete Ratzel die Erkenntnis daraus ab, dass die Völker der Erde sich in einem permanenten Kampf um den knappen Raum befinden. Wachstum und sicheres Überleben könne nur durch Expansion auf Kosten anderer erfolgen, vorzugsweise durch die Eroberung von Kolonien. Am Beispiel der See- und Weltmacht Großbritannien beschrieb er, welche materiellen Voraussetzungen (geografische Lage, Topografie, Größe, naturräumliche Gegebenheiten, Grenzen, Bodenbeschaffenheit, Klima, Bevölkerungsentwicklung, Ressourcen) gegeben sein müssen, um die Welt beherrschen zu können. Ratzel sah sich aber nicht nur als Wissenschaftler, sondern vor allem als Ratgeber und „Arzt für den Staatsorganismus“, der den Politikern mehr Sinn für die aus den geografischen Gegebenheiten folgenden Handlungsimpulse („Expansionstrieb“, „Herrschergeist“) einbläuen wollte.Placeholder image-1Das „eingezwängte“ Deutschland, so die Empfehlung des Geografen, müsse sich endlich „Luft machen“, sonst werde es noch ersticken. Wie zahlreiche Professoren im Wilhelminischen Kaiserreich engagierte sich Ratzel, der 1870/71 im deutsch-französischen Krieg gekämpft hatte, im rechtskonservativen Alldeutschen Verband, im aufrüstungsvernarrten Flottenverein und in der Deutschen Kolonialgesellschaft. 1901 prägte er den Begriff „Lebensraum“, den die Nationalsozialisten später dankbar für ihre Kriegsziele im Osten okkupierten.Der Staat als OrganismusDie Bezeichnung Geopolitik erfand jedoch nicht der Geograf Ratzel, sondern der schwedische Staatsrechtler Rudolf Kjellén (1864 – 1922). Er benutzte das Wort erstmals 1899 in einem Aufsatz über „Schwedens politische Grenzen“. Kjellén, ein deutschfreundlicher Wortführer der Jungrechten im schwedischen Reichstag, lehnte die liberale, von der Französischen Revolution inspirierte Staatsauffassung ab, nach der ein Staat vor allem den Rechtsschutz für Bürger und Unternehmen zu garantieren habe (Rechts- und Verfassungsstaat). Stattdessen propagierte er, in Anlehnung an Ratzel, den Staat als „geografischen Organismus“ mit entsprechendem Eigenleben und biologischem Selbsterhaltungstrieb (Machtstaat). Staaten, so Kjellén, seien „mächtige Lebewesen mit selbstständigen Zielen, Wesen, die sich im Kampf ums Dasein aus eigener innerer Kraft entwickeln“.Sein 1917 publiziertes Opus magnum Der Staat als Lebensform erhob den Staat praktisch zur Nationalreligion. Eine Aufwertung, die nicht nur der geistigen Mobilmachung im Krieg geschuldet war, sondern auch der ideologischen Rechtfertigung des deutschen Militarismus diente. Im September 1914 hatte Kjellén das Manifest der 93 unterzeichnet, einen pathetischen Aufruf deutschnational gesinnter Professoren, die in der wilhelminischen Kriegführung einen verzweifelten Akt der Selbstverteidigung erkennen wollten: Deutscher Geist müsse sich notgedrungen gegen die Gier englischer „Krämerseelen“, gegen „gallische Oberflächlichkeit“ und „slawischen Despotismus“ zur Wehr setzen. „Als Schwede“, schrieb Kjellén, „muss ich ein starkes Bollwerk gegen die Macht im Osten wünschen, von der eine Bedrohung gegen Kultur und Staat meines Landes ausgeht“.Placeholder image-2Seinen Höhepunkt erlebte das geopolitische Denken in Mitteleuropa aber erst nach dem Ersten Weltkrieg. Denn 1919 wurde Geopolitik als akademische Disziplin anerkannt, gepflegt an Universitäten, Kriegsschulen und Kriegsakademien. Ihr Hauptprotagonist wurde der Münchner Militärgeograf Karl Haushofer (1869 – 1946), der im Ersten Weltkrieg als Generalstabsoffizier der bayerischen Armee gedient hatte und dessen Familie mit Ratzel befreundet war. Dem jungen Karl war der ältere Ratzel ein leuchtendes Vorbild, sowohl in soldatischer als auch in wissenschaftlicher Hinsicht. Auch Kjellén zählte zu Haushofers Idolen.Die Frage, die viele Geopolitiker der 1920er-Jahre bewegte, war, wie Deutschland auf die demütigende Niederlage und den „skandalösen“ Versailler Vertrag reagieren sollte. Es bildete sich ein professoraler Ersatz-Imperialismus, der das Weltkriegstrauma durch wissenschaftlich eingekleidete Revanche-Gedanken zu kompensieren versuchte. Zwischen 1924 und 1944 gaben Haushofer und Erich Obst, später auch Hermann Lautensach und Otto Maull (letztere schlossen sich schon bald den Nationalsozialisten an) die Zeitschrift für Geopolitik heraus, die sich in den Anfangsjahren für eine eurasische Kooperation zwischen den Landmächten Deutschland und Russland stark machte, später – unter dem Eindruck der Zeitenwende von 1933 – die Revision des Versailler Vertrags und eine aggressive Ostexpansion auf die redaktionelle Agenda setzte.Obwohl Haushofer ursprünglich der Idee anhing, dass Deutschland nur in einem Bündnis mit Russland und Japan aus dem „Würgegriff des Angelsachsentums“ herausgerissen werden könne, ließ sich seine Theorie ebenso gut in die antisowjetische Propaganda der Nazis integrieren. Denn Geopolitik war im Kern immer anpassungsfähig, ihr apolitisches, von Wunschdenken geprägtes „Gesetz der wachsenden Räume“ machte aus ihr das ideale „Werkzeug der Verdummung und der geistigen Vernebelung“. 1939 schrieb Haushofer zu Hitlers 50. Geburtstag, der Führer vereine in seiner Person „Clausewitz’ Blut und Ratzels Raum und Boden“. 1941 übersandte Haushofer, der bis 1925 der liberalen Deutschen Volkspartei (DVP) angehört hatte, ein serviles Dankschreiben an den Reichsführer SS, Heinrich Himmler.Nach 1945 war erstmal Schluss mit GeopolitikEs ist daher kaum verwunderlich, dass Haushofers Geopolitik nach 1945 keine Gnade fand. 1957 sprach ihr der Geograf Peter Schöller jeden wissenschaftlichen Wert ab, „nicht nur wegen ihrer politischen Dienstbarkeit, ihrer Verschwommenheit und ihres Mangels an Logik, sondern vor allem wegen ihrer grundsätzlichen These: ‚Der Staat ist ein Organismus‘“. Diese pseudowissenschaftliche Verklärung sozial-darwinistischen Machtstrebens unter Zuhilfenahme bemalter Landkarten, dilettantischer Kräfteparallelogramme und grausamer geografischer Simplifikationen habe Hitlers radikale Politik in naiver Weise beglaubigt. Geopolitisches Denken schien damit in Mitteleuropa ein für alle Mal erledigt. Nur die angelsächsische Linie lebte munter weiter.Die beiden Weltmächte des 19. und 20. Jahrhunderts, Großbritannien und die USA, hatten biologistische, idealistische oder religiöse Überhöhungen für ihre imperialen Ziele nie besonders nötig gehabt, ihnen genügte eine möglichst eingängige, pragmatische und leicht nachvollziehbare Begründung dafür, wie die eigene Vorherrschaft am besten zu sichern sei. Denn Seemächte, nicht Landmächte, bestimmten seit Kolumbus’ Zeiten, wer über die nötigen Weltherrschaftsfähigkeiten verfügt. Und so war es ein Konteradmiral der US Navy, der die Grundlagen der angelsächsischen Geopolitik entwickelte: Alfred Thayer Mahan (1840 – 1914), „der Clausewitz der See“, skizzierte in seiner 1890 erschienenen Schrift The Influence of Sea Power upon History die US-Doktrin der Seeüberlegenheit, ein militärisches Grundlagenwerk, das Kaiser Wilhelm II. zur Pflichtlektüre für die deutsche Marine erhob.Placeholder image-4Mahans Konzept beeinflusste aber vor allem den britischen Geografen und konservativen Unterhausabgeordneten Halford Mackinder (1861 – 1947), den man mit Fug und Recht als den wohl einflussreichsten Geopolitiker der Welt bezeichnen kann. 1904 erläuterte Mackinder in seinem Werk The Geographical Pivot of History seine berühmt-berüchtigte Heartland-Theorie. Sie besagt, dass derjenige, der das eurasische Kernland, das „Heartland“, kontrollieren könne, den Schlüssel zur Weltherrschaft besitze. Mackinders ebenso schlichter wie origineller Dreisatz lautete: Wer über Osteuropa herrscht, beherrscht das Herzland. Wer über das Herzland herrscht, beherrscht die Weltinsel (gemeint sind Eurasien und Afrika). Und wer über die Weltinsel herrscht, beherrscht die Welt.Den bekennenden Imperialisten Mackinder trieb die Sorge um, dass Großbritanniens allmählich schwindende Macht von den aufstrebenden Landmächten Eurasiens (Deutschland und Russland) abgelöst werden könnte. Der Grund: Das „Herzland“, diese riesige Landmasse von der Wolga bis nach Ostasien, von der Arktis bis zum Himalaja, war für die britische Kanonenbootpolitik, die ihre Macht einem weitmaschigen Netz von Küstenstützpunkten verdankte, unerreichbar.Im unzugänglichen Herzland sah Mackinder deshalb einen idealen Rückzugs- und Sammlungsort für künftige Rivalen Großbritanniens. Das schnell wachsende Eisenbahnnetz würde schon bald Truppen und Material an jeden noch so entlegenen Ort transportieren können und den jahrhundertelangen Vorteil der Seemächte zunichte machen. Die größte Gefahr für das britische Empire sah Mackinder jedoch in der Möglichkeit eines deutsch-russischen Kontinentalbündnisses. Russische Rohstoffe und deutsche Präzisionstechnik könnten eine unheilvolle Verbindung eingehen. Folgerichtig nannte er das von ihm definierte Herzland den Dreh- und Angelpunkt der Weltgeschichte, den „Pivot of History“.Placeholder image-3Mackinders kühner Entwurf einer angelsächsischen Geopolitik, verfasst in der Hochphase des Imperialismus, wäre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Untergang sowohl des deutschen Kaiser- als auch des russischen Zarenreichs wohl in Vergessenheit geraten, hätte er nicht durch den Hitler-Stalin-Pakt vom August 1939 eine späte Bestätigung erfahren. Mit dem deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt schien genau jene Situation eingetreten zu sein, vor der Mackinder 1904 eindringlich gewarnt hatte. Der Teufelspakt von Moskau machte den Briten – so der Leipziger Historiker Oliver Krause – „über Nacht zum geopolitischen Propheten und die Heartland-Theorie zur Blaupause für den kommenden Weltkonflikt“. Der Westen geriet in Alarmstimmung. Denn wer das Herzland beherrscht, bedroht in Kürze die ganze demokratisch-liberale Weltordnung.Adaptiert und popularisiert wurde Mackinders Theorie zunächst durch die damalige First Lady des US-Journalismus, Dorothy Thompson, die in der New York Herald Tribune ihre wöchentliche Kolumne On the Record für geopolitische Fragen öffnete. Parallel dazu integrierte der Geopolitikprofessor Edmund A. Walsh (1885 – 1956), der nach dem Ersten Weltkrieg die US-Diplomatenschmiede School of Foreign Service gegründet hatte, Mackinders Theorie in den akademischen Lehrbetrieb. In die Ausformulierung der „Grand Strategy“ der US-Außenpolitik gingen aber vor allem die Arbeiten des niederländisch-amerikanischen Geostrategen Nicolas J. Spykman (1893 – 1943) ein, der Mackinders Weltherrschafts-Theorie zeitgemäß weiterentwickelt hatte. 1942, mitten im Zweiten Weltkrieg, veröffentlichte er die Studie America’s Strategy in World Politics.Um das Herzland, die erstarkende Sowjetunion, auch künftig in Schach halten zu können, müsse, so Spykman, das Augenmerk der USA auf dessen Ränder gelegt werden, auf Skandinavien, Westeuropa, den Balkan, den Nahen Osten, den Kaukasus, Iran, Indien und China. Spykmans sogenannte Rimland-Theorie, in die auch einige Gedanken Karl Haushofers einflossen, inspirierte im beginnenden Kalten Krieg die Containment- oder Eindämmungsstrategie des US-Diplomaten George F. Kennan. Wer das Rimland beherrsche, so Spykmans Grundsatz, beherrscht Eurasien. Deshalb sei es im Interesse der USA, das vereinte Europa zu einem US-Bollwerk zu machen und das besiegte Deutschland so weit aufzurüsten, dass es – eingebunden in die Strukturen der Nato – ein Gegengewicht zur Sowjetunion bilden könne. Deutschland und Russland sollten nie wieder zueinanderfinden.Russische GroßraumideenZu den Schülern Spykmans, Mackinders und Mahans zählten eine ganze Reihe einflussreicher US-Außenpolitiker, von dem erwähnten George F. Kennan bis zum ehemaligen nationalen Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski, vom US-Senator und Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, James William Fulbright, bis zu Ex-US-Außenminister Henry Kissinger. Sie alle galten – wie heute etwa der Chicagoer Politikwissenschaftler John Mearsheimer – als Vertreter der realistischen Schule im Lehrfach Internationale Beziehungen. Das heißt, sie teilten auch Mackinders Einsicht, dass die Landmasse im Herzen Eurasiens militärisch nicht eingenommen werden könne. Zumindest nicht zu vertretbaren Kosten.Nach dem Ende des Kalten Krieges verschwand die geopolitische Debatte in den USA und Großbritannien für einige Jahre aus den Köpfen, um einer idealistischen Sichtweise vom „Ende der Geschichte“ (Francis Fukuyama) Platz zu machen. Doch nach der Besetzung der Krim durch Russland im Jahr 2014 kehrte das alte geopolitische Denken mit Macht zurück. Heute befeuern Publizisten wie der Brite Tim Marshall (Die Macht der Geographie im 21. Jahrhundert) oder Historiker wie der Brite Peter Frankopan (Die neuen Seidenstraßen) das Narrativ von der „Rückkehr der Geopolitik“, zumal auf der Gegenseite, in Putins Russland, ebenfalls an das „Great Game“ der imperialistischen Mächtekonkurrenz angeknüpft wird. Die russischen Großraumideen verhalten sich dabei komplementär zu den angelsächsischen. Denn auch Russlands Geopolitiker haben Mahan, Mackinder und Spykman genau studiert. Ihre Leidenschaft gilt jedoch der kontinentaleuropäischen Linie um Friedrich Ratzel, Rudolf Kjellén und Karl Haushofer.In den 1920er-Jahren hatte sich unter antibolschewistisch gesinnten Exilrussen der geopolitische Wunschtraum nach einem anti-westlichen, russisch kontrollierten Eurasien entwickelt. Man war der festen Überzeugung, dass das durch die lange Mongolenherrschaft geprägte Ostslawentum im Lauf der Jahrhunderte eine eigene erdverbundene Kultur hervorgebracht habe, die das Gegenmodell zum westlichen, auf die Beherrschung der Meere ausgerichteten „Atlantismus“ bilde.Der russische Ultranationalist Alexander Dugin, Professor an der Moskauer Militärakademie (sein 1997 erschienenes Buch Die Grundlagen der Geopolitik dient den dortigen Militärs als Lehrbuch), hat den Wunschtraum der Anti-Bolschewisten weitergesponnen und in russischen Debattenzirkeln eine regelrechte Eurasien-Euphorie ausgelöst. Dugins Neo-Eurasismus („von Dublin bis Wladiwostok“) verwurstet in wilder Mischung das rechtsradikale Gedankengut Carl Schmitts und der deutschen „konservativen Revolution“ mit den geopolitischen Lehren Mackinders und Haushofers. Dugins Ziel ist es, die kulturelle und militärische Dominanz der USA zu beenden und Europa (insbesondere Deutschland) an die Seite Moskaus zu führen. Denn nur die Befreiung von der westlichen Dekadenz garantiere den Europäern wieder eine dauerhaft stabile Ordnung.Im Kern militärischEtwas weniger versponnen, aber in die gleiche Richtung argumentiert der Moskauer Politikwissenschaftler und außenpolitische Putin-Berater Sergej Karaganow. Auch er will die Welt teilen, in ein Groß-Eurasien im Osten und ein Groß-Amerika im Westen. Moskau und Washington sollen aber nicht mehr gegeneinander arbeiten, sondern gemeinsam – in einer Art Großmächtekonzert – die Welt kontrollieren und die Befriedung regional aufflammender Konflikte nach Gutsherrenart unter sich regeln. Sicherheitspolitisch liefe Karaganows Konzept auf einen kollektiven oder „multipolaren Neo-Imperialismus“ der Großmächte hinaus, wirtschaftlich geht es ihm darum, gemeinsam mit China und Europa – in einer Art eurasischem Commonwealth – die Weiten Sibiriens zu entwickeln, was er als Win-win-Situation für alle Beteiligten interpretiert. Vor allem Deutschland wird als Wunschpartner heftig umworben.Ähnlich wie Spykman, der zur Aufrechterhaltung der US-Vorherrschaft einen Sicherheitsgürtel aus Randstaaten um das feindliche Russland legen wollte, will Karaganow einen von Moskau geschaffenen Sicherheitsgürtel um das eurasische Herzland legen, eine Pufferzone, die von Japan über China, Indonesien, Indien, den Iran und die Türkei bis nach Ägypten reicht. Dass Deutschland sowohl in den angelsächsischen wie in den russischen Geopolitik-Konzepten eine herausragende Rolle spielt, dürfte hierzulande für zunehmend hitzige Debatten zwischen Transatlantikern und Eurasiern sorgen. Gemeinsam ist den Stammtisch-Strategen in Ost und West ein archaisches Großraumdenken, das man nach dem Zweiten Weltkrieg im europäischen Friedensprojekt EU für überwunden glaubte. Nun aber fühlen sich mehr und mehr Europäer von der aggressiven Machtpolitik der anderen herausgefordert und meinen, keine andere Wahl mehr zu haben, als sich dem Wahn des geopolitischen Denkens anzuschließen. Und so spricht die EU-Kommission allen Ernstes von ihrem „geopolitischen Erwachen“ und der notwendigen Verwandlung ihrer (wirtschaftlichen) Soft Power in (militärische) Hard Power.Die Idealisten unter den Politikwissenschaftlern und Friedensforschern pflegten eine Zeit lang die Hoffnung, eine „kritische“, ja eine „linke Geopolitik“ als Gegengewicht zu den imperialen Strategien etablieren zu können: eine Geopolitik, die aus den Fehlern des 20. Jahrhunderts die notwendigen Schlüsse zieht und Missbrauch durch politische Instrumentalisierung von vornherein ausschließt. Doch das ist pure Illusion. Versuche, geopolitisches Denken zu demokratisieren, sind bereits im Ansatz gescheitert. Die in den späten 1970er-Jahren entstandenen Nachfolgekonzepte, die neomarxistisch angehauchte „radikale Geografie“ des US-amerikanisch-britischen Humangeografen David Harvey, die „kritische Geopolitik“ des irischen Historikers Gearóid Ó Tuathail und die „geografische Konfliktforschung“ im Umkreis der europäischen Friedensforschungsinstitute fristeten stets ein Schattendasein und wurden 1989 von der weltpolitischen Zeitenwende über den Haufen geworfen.Denn Geopolitik ist nicht reformierbar. Sie bleibt eine imperialistische Ideologie. Sie entpolitisiert Machtpolitik, indem sie Expansions- und Eroberungspläne zu naturhaften Prozessen verklärt. Sie unterstützt die Herrschaftsgelüste der Mächtigen mit „objektiver“ Geografie und will sie so gegen Kritik immunisieren. Sie ist Politikberatung, nicht Wissenschaft. Im Kern vertritt sie ein militärisches Konzept, das die Politik schleichend infiziert und schließlich vereinnahmt. Mit einem Wort: Geopolitik ist stets ein sicherer Weg zum Krieg.