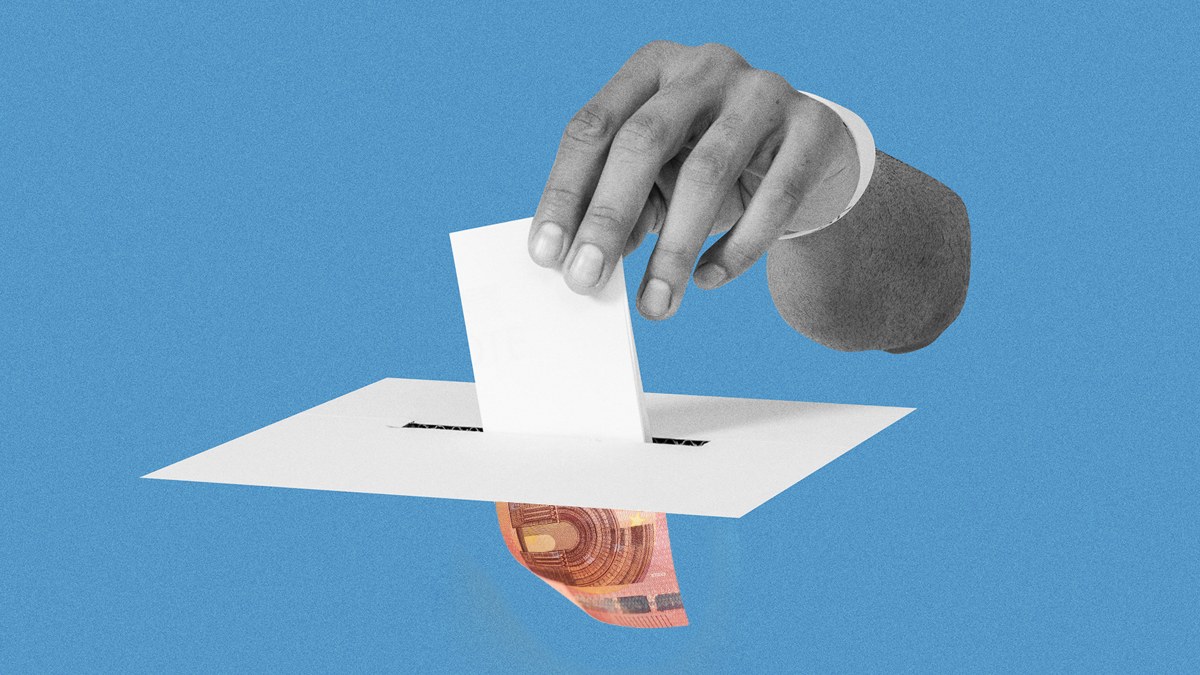Die Angriffe auf die Zivilgesellschaft nehmen zu. In den USA wettert Donald Trump gegen NGOs und progressive Bewegungen, Elon Musk nutzt seine Plattformen, um sie als „Marionetten des Staates“ zu diffamieren. In Ungarn hat Viktor Orbán die unabhängige Zivilgesellschaft faktisch entmachtet, und hierzulande hinterfragt die CDU in einer Kleinen Anfrage, ob regierungskritische Organisationen überhaupt öffentlich gefördert werden sollten. All das ist kein Zufall. Es zeigt: Die Zivilgesellschaft wird zunehmend als Bedrohung betrachtet und gezielt geschwächt.
Doch die wahre Gefahr liegt nicht nur in diesen Angriffen selbst, sondern auch in der trügerischen Hoffnung, dass staatliche Finanzierung ein sicherer Anker bleibt. Die Zivilgesellschaft muss sich ihrer eigenen Stärke bewusst werden – und darf sie nicht aus den Händen geben. Viele Organisationen sind von öffentlichen Mitteln abhängig, um ihre wichtige Arbeit zu leisten. Zum Teil auch wir. Zur gemeinnützigen gut.org-Gruppe gehört nicht nur Deutschlands größte Spendenplattform betterplace.org und das Stiftungs-Startup bcause, die beide täglich Hilferufe von Organisationen erhalten, denen staatliche Zuwendungen gestrichen wurden. Zu gut.org gehört auch das betterplace lab und das NETTZ, zwei selbst überwiegend von öffentlichen Mitteln finanzierte Organisationen, die sich für eine lebendige Zivilgesellschaft und für eine respektvolle Diskussionskultur im Internet einsetzen.
Kein moralisches Recht auf öffentliche Finanzierung
Die Arbeit in der Zivilgesellschaft war nie bequem. Die Gehälter sind niedriger, unbefristete Arbeitsverträge selten. Aber wir haben uns im Kopf eingerichtet, verstehen die Nachteile als Preis für ein anderes, ein höheres Gut: das Gefühl, das Richtige zu tun. Auch legen die Aufrufe und Unterschriftenaktionen der letzten Wochen so viele existenzielle Sorgen offen. Anders als in den von uns oft als „freie Wirtschaft“ bezeichneten Märkten formulieren viele sozial Engagierte für sich eine Art Anspruch und moralisches Recht auf öffentliche Finanzierung. Diesen gibt es aber nicht. Die Politik kann sich ändern und damit auch die Förderschwerpunkte. Sieht eine neue Regierung NGOs als Gegner, kann sie die Förderung streichen oder erschweren – oft mit einem Federstrich. Wer sich ausschließlich auf staatliche Mittel verlässt, lebt riskant und macht sich erpressbar.
Zudem begünstigt diese Abhängigkeit das Narrativ der Gegner: Sie unterstellen, die Zivilgesellschaft sei ein verlängerter Arm des Staates, sie agiere nicht wirklich autonom. Völlig ignoriert wird von Kritikern, dass der Staat sich natürlich sozialer Organisationen als Partner bedient, um Leistungen der Daseinsvorsorge zu erbringen, die niemand in Frage stellt. Ungeachtet davon diskreditiert der Vorwurf NGOs schon jetzt – und das wird sich noch verstärken.
Für ein neues Geben
Die Antwort kann nur sein: Die Zivilgesellschaft muss ihre Finanzierung selbst in die Hand nehmen. Spenden und Mitgliedsbeiträge sind keine Nebensache – sie sind essenziell für Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit. Organisationen, die stark auf private Unterstützung setzen, sind weniger angreifbar und können selbstbewusster auftreten. Sie müssen nicht befürchten, dass ihre Finanzierung von politischen Stimmungen abhängt.
Doch dafür braucht es ein neues Geben. In Deutschland wird zwar gespendet, aber im internationalen Vergleich immer noch viel zu wenig. Die Besserverdienenden spenden nur halb so viel wie die Geringverdiener – so gibt es eine Spendenlücke von zwei Milliarden Euro pro Jahr. Auch Stiftungen bleiben weit hinter ihrem Potenzial zurück. Nimmt man die Entwicklung der Privatvermögen als Maßstab, sind 30 Milliarden Euro weniger in Stiftungsvermögen angekommen, als zu erwarten gewesen wäre. Und auch die Tatsache, dass in Deutschland inzwischen nur noch ein Viertel der Bevölkerung an gemeinnützige Organisationen spenden, ist ein Alarmsignal. 2010 lag der Anteil noch bei 36 Prozent.
Hier sind drei konkrete Ideen, um mehr privates Geld für die Zivilgesellschaft zu mobilisieren:
- Mehr Menschen in Deutschland sollten regelmäßiger spenden. Nur so hat zivilgesellschaftliches Engagement eine Perspektive. In mehreren osteuropäischen Ländern können Bürger über ihre Steuererklärung bestimmen, dass ein bzw. zwei Prozent ihrer Einkommenssteuer direkt an eine NGO ihrer Wahl geht. Dieses Modell fördert zivilgesellschaftliches Engagement, stärkt unabhängige Organisationen und sensibilisiert Menschen für die Bedeutung ihrer Unterstützung. Eine solche Regelung könnte auch in Deutschland eingeführt werden – idealerweise mit einer breiten Auswahl an förderfähigen NGOs, um Vielfalt zu sichern. Die Ampel-Bundesregierung hat hierfür mit dem Zuwendungsempfängerregister bereits eine passende Datenbasis geschaffen.
- Die meisten Stiftungen sind darauf ausgerichtet, ihr Kapital zu bewahren und nur die – oft vergleichsweise geringen – Erträge für gemeinnützige Zwecke einzusetzen. Das ist aus der Zeit gefallen, wenn es darum geht, dringende gesellschaftliche Herausforderungen zu meistern. Mit einer Umwandlungsmöglichkeit von Ewigkeits- in Verbrauchsvermögen könnten mehrere tausend Stiftungen sofort um ein Vielfaches mehr Gelder ausschütten. Die steuerliche Besserstellung von Zustiftungen ins Grundstockvermögen gegenüber zeitnah zu verwendenden Spenden sollte umgedreht und eine größere Klarheit und Flexibilität bei der Finanzierung politischer Aktivitäten und Impact Investing geschaffen werden.
- Eine häufige Hürde für Spendenbereitschaft ist das Misstrauen gegenüber der Verwendung von Geldern. Um dieses Vertrauen zu stärken, sollte ein verpflichtendes Mindestmaß an Transparenz für alle gemeinnützigen Organisationen eingeführt werden. Jede Organisation, die öffentliche oder steuerlich begünstigte Spenden erhält, sollte jährlich eine leicht verständliche, standardisierte Übersicht über Einnahmen und Ausgaben veröffentlichen. Als Ansatz könnten die 10 Transparenzpunkte der Initiative Transparente Zivilgesellschaft dienen.
Große Skepsis gegen private Mittel
Diese drei Maßnahmen würden helfen, die finanzielle Basis der Zivilgesellschaft zu verbreitern und ihre Unabhängigkeit nachhaltig zu sichern. Denn in Anbetracht der politischen Lage liegt die Lösung darin, das Thema Finanzierung unabhängiger von der Politik zu machen und selbstbewusst in die öffentliche Debatte zu bringen. NGOs und Initiativen sollten offensiver kommunizieren, warum finanzielle Unabhängigkeit entscheidend ist. Sie müssen Menschen klar machen, dass Spenden nicht nur „nett“ sind, sondern notwendig, um Vielfalt, Demokratie und soziale Gerechtigkeit zu sichern.
Warum ist das nicht schon lange passiert? Dabei müssen soziale Organisationen auch selbstkritisch sein: An vielen Stellen gibt es große Skepsis gegenüber privaten Mitteln. „Wenn gespendet werden muss“, so eine häufige Meinung, „dann hat dort der Staat bereits versagt“. Wenn aber private Finanzierungen oft nur zweite Wahl sind, dann muss man sich über das Ergebnis nicht wundern. Der öffentliche Diskurs sollte nicht lauten: „Warum wird diese Organisation mit Steuergeldern unterstützt?“, sondern: „Wie können wir sicherstellen, dass diese Organisation langfristig bestehen kann?“ Hier ist ein Umdenken notwendig. Die Zivilgesellschaft muss dieses Umdenken aktiv vorantreiben. Und die Zivilgesellschaft, das sind nicht nur die Mitarbeitenden in den Organisationen, sondern wir alle, die etwas (mehr) geben können.
Existenzielle Finanzierungsprobleme
Viele zivilgesellschaftliche Akteure haben akute, existenzielle Finanzierungsprobleme. Und was tut man, wenn man am Abgrund steht? Schreibt Aufrufe und startet Unterschriftenaktionen, sucht Zugang zu Koalitionsverhandlungen, versucht wenigstens einen Teil der alten Sicherheit zu retten. Man schaut nach hinten, sucht sich verzweifelt Halt, wo eben noch welcher war.
Es ist eine unbequeme Wahrheit: Aber wir müssen stattdessen springen. Nach vorn. Seien wir uns bewusst: Die Angriffe auf NGOs und zivilgesellschaftliche Akteure werden nicht abnehmen. Im Gegenteil, sie werden zunehmen und sehr erfolgreiche Organisationen besonders intensiv treffen. Wer sich auf staatliche Mittel verlässt, geht ein Risiko ein. Wer sich auf breite gesellschaftliche Unterstützung stützt, bleibt stark.