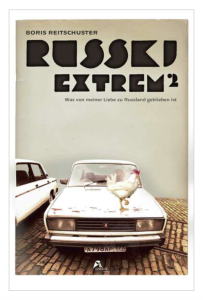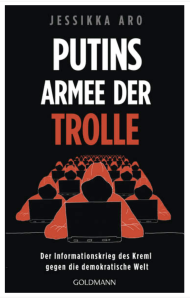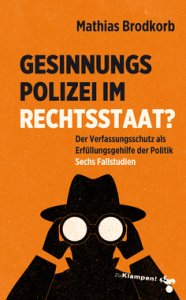Lesen Sie heute Teil 31 von „Putins Demokratur“. Warum ich Buch hier auf meiner Seite veröffentliche, können Sie hier in meiner Einleitung zum ersten Beitrag finden.
In der unbekannten Petersburger Fachzeitschrift Notizen der Bergbau-Hochschule erscheint im Januar 1999 ein sehr langer Artikel mit sehr vielen Hauptwörtern und Genitivkonstruktionen wie »Hauptreserve der Verwandlung Russlands« oder »Erhöhung des Lebensstandards der Mehrheit der Bevölkerung«. Der Beitrag findet keine große Resonanz. Zu Unrecht. Der Autor schreibt über Energiepolitik, über die Zukunft Russlands und seiner Wirtschaft. Langatmig und zuweilen etwas monoton finden sich hier viele Argumente dafür, dass Bodenschätze der Hebel sind, mit dem Russland zu alter Größe und neuem Wohlstand kommen kann. Das Potential des Landes an natürlichen Ressourcen wie Öl und Gas weise ihm einen besonderen Platz unter den Industriestaaten zu, heißt es in dem Artikel.
Die Entwicklung der rohstoffverarbeitenden Industrie sei »die wichtigste Ressource, um Russland in relativ naher Zukunft zur führenden wirtschaftlichen Großmacht zu machen«. Der Autor des 1999 veröffentlichten Artikels ist zu dieser Zeit nur politisch Interessierten ein Begriff. Und so sorgt es kaum für Verwunderung, dass sich da jemand mit dem Thema Rohstoffe befasst, dessen Ausbildung und Beruf ihn nicht als Energiespezialisten qualifizieren. Der Verfasser ist Russlands oberster Geheimdienstler – der Vorsitzende des FSB. Wladimir Putin.
Heute liest sich der Artikel aus der kleinen Fachzeitschrift des Petersburger Bergbau-Instituts, als sei er die Handlungsanweisung für Putins Wirken im Kreml. Russland müsse »große, branchenübergreifende Finanz- und Industriekorporationen« schaffen, die in der Lage seien, »auf Augenhöhe mit den transnationalen Korporationen des Westens zu konkurrieren«. Russlands Rohstoffwirtschaft spiele eine wichtige Rolle in allen Lebensbereichen des Staates, heißt es weiter in dem Artikel aus dem Jahr 1999. Unter anderem »ist sie die Grundlage für die Verteidigungsmacht des Landes« sowie die »unbedingte Voraussetzung für die Vervollkommnung des militärisch-industriellen Komplexes« – die unfreiwillige Doppeldeutigkeit und Komik ist wohl nicht beabsichtigt – und schafft »die notwendigen strategischen Reserven und Potentiale«. Mit marktwirtschaftlichen Mechanismen könne man keine wichtigen strategischen Fragen lösen, schreibt Putin und verweist auf die Erfahrungen während der Reformen: Weil der Staat die Rohstoffsphäre »vorübergehend aus der Hand gegeben« habe, sei es in ganzen Wirtschaftszweigen zu Stagnation und Niedergang gekommen.
Auch Putins Doktorarbeit, die er 1997 im Jahr nach seinem Ausscheiden aus der Stadtverwaltung an der Petersburger Bergbau-Hochschule ablegte, liefert Erklärungen für die Entwicklung der russischen Wirtschaft. Warum sich der studierte Jurist und Geheimdienstler Putin, als Vizebürgermeister zuständig für den Außenhandel, plötzlich der Rohstoffproblematik zuwandte, ist nur zu erahnen. Offiziell hatte Putin erstmals durch die umstrittenen Rohstoff-für-Lebensmittel-Geschäfte zu Beginn seiner politischen Laufbahn mit dem Rohstoffsektor zu tun. Außerdem war er 1994 für die Privatisierung der Petersburger Ölgesellschaft PTK zuständig, deren Vorsitz später sein schon erwähnter Datschen-Nachbar Wladimir Smirnow übernahm.
In seiner Doktorarbeit ist viel von einer wichtigeren Rolle des Staates und der Notwendigkeit einer »grundlegenden Umgestaltung der Volkswirtschaft« die Rede. Putin, der von vielen Anhängern im Westen als Liberaler betrachtet wird, beschreibt hier, was er unter einer guten Wirtschaftspolitik, vor allem im Energiebereich, versteht: »Die Steuerung durch den Staat entspricht in großem Maße den Erfordernissen Russlands.« Ausländische Investitionen in den russischen Energiesektor sollten erst zugelassen werden, wenn »die Möglichkeit des Staates, die nationalen Interessen zu verteidigen, bestätigt ist«.
Als Putin Präsident ist, beginnt er diese Positionen umzusetzen. Der Kreml kontrolliert 80 Prozent der Erdgasförderung im Land. Binnen weniger Monate erhöht der Staat seinen Anteil im Ölsektor von 6 auf 35 Prozent, er könnte noch auf 50 bis 60 Prozent steigen. 20 Jahre nach dem Beginn der Perestroika ist der Staat wieder zum wichtigsten Anteilseigner der Branche aufgestiegen –Tendenz steigend.Auch die privaten Ölfirmen treffen strategisch wichtige Entscheidungen nur noch nach Rücksprache mit dem Kreml. Fachleute sprechen von einer »Lukoilisierung«: Der Ölkonzern Lukoil ist in privater Hand, verfolgt aber staatliche Interessen.
»Egal, in wessen Besitz sich Rohstoffe befinden, der Staat hat das Recht, den Prozess ihrer Förderung und Nutzung zu regulieren«, stand schon in Putins Doktorarbeit. Dass der spätere Präsident das sehr ernst meinte, bekam Yukos-Chef Michail Chodorkowski zu spüren, als er sich mehrfach gegen Anweisungen des Kreml stellte. Gegen den Willen Moskaus wollte er einen US-Konzern zum Miteigentümer von Yukos machen und in Eigenregie eine Pipeline nach China bauen. Heute sitzt er im Gefängnis.
Putin kann mit seiner Position auf die Unterstützung der meisten Russen rechnen. Die oft mit zwielichtigen Methoden betriebene Privatisierung der Jelzin-Zeit wird von den Menschen zu Recht als Raub der russischen Naturschätze verurteilt. Und sie haben allzu gut in Erinnerung, wie die neuen Eigentümer Russlands Reichtum für ihre persönlichen Zwecke ausbeuteten, wie sie sich kaum um soziale Belange kümmerten, mit dubiosen Steuersparmodellen den Staat um seinen Anteil brachten und oft kaum etwas von ihren gigantischen Gewinnen in die Produktion investierten, die zum großen Teil immer noch von der alten Substanz
und den Erkundungen aus sowjetischen Zeiten zehrte. Weil der Übergang zur Markwirtschaft im Fiasko endete, sehnen sich die Russen – und mit ihnen Wladimir Putin – zurück nach den alten Rezepten aus der Sowjetzeit: Der Staat soll es richten.
Wie die meisten Vorwürfe an seine Adresse weist Putin auch die Kritik an seinem Verstaatlichungskurs mit dem Argument zurück, er tue nichts anderes als der Westen. Auch dort gäbe es Beispiele für staatliche Einmischung im Rohstoffsektor, sagt der Präsident und verweist etwa auf Norwegen, wo bei einem staatlichen Öl- und Gasmonopol effektives Wirtschaften möglich ist. Dass dort eine völlig andere Staatskultur herrscht, lässt Putin außen vor. In Norwegen ist Korruption eine Ausnahme, und es ist nichts über Staatsdiener bekannt, die sich am staatlichen Eigentum vergreifen.
Tatsächlich schaffte der russische Ölsektor nach der Privatisierung ein kleines Wirtschaftswunder. Stand die Branche Anfang der neunziger Jahre noch vor dem Ruin und benötigte ständige Finanzspritzen, so erhöhte sich die Ölförderung, die zuvor rückläufig gewesen war, in den vergangenen zehn Jahren im Wesentlichen dank der privaten Konzerne um 50 Prozent. Im Jahr 2003 stieg sie um 9, im Jahr 2004 um 11 Prozent. Dann kehrte sich der Trend um: 2005 legte die Ölförderung nur noch um 2,4 Prozent zu und für 2006 erwarten Fachleute erstmals ein Sinken. Der Hintergrund: Bei den privaten Konzernen stieg die Ölförderung zwischen 2001 und 2004 dreimal so stark an wie bei der staatlichen Konkurrenz. Nahm 2004 die private TNK-BP pro Beschäftigtem 171 000 Dollar ein, so war es bei der staatlichen Rosneft nur die Hälfte. Solche Zahlen belegen nach Ansicht von Fachleuten, dass private Konzerne weitaus effizienter sind als die staatliche Konkurrenz.
Russlands Regierung wirft derweil den privaten Firmen vor, sie seien nicht effektiv – und überlegt im Mai 2006 laut, westlichen Firmen die bereits unterzeichnete Mehrheitsbeteiligung an gigantischen Öl- und Gasfeldern auf der Insel Sachalin im Nordpazifik wieder zu entziehen: Die Ausländer trieben die Kosten und verzögerten das Projekt, kritisiert das Ministerium für Bodenschätze unter Berufung auf Forscher. Die schlagen vor, den Anteil russischer Firmen an dem Milliardenprojekt auf 51 Prozent zu erhöhen – dabei würde eine nachträgliche Änderung der Anteilsverhältnisse gegen das russische Gesetz verstoßen. Exxon Mobil hat bisher knapp 4 Milliarden Euro in das Projekt investiert, Royal Dutch Shell mit seinen Partnern mehr als 16 Milliarden Euro.
Sollte Russland die Verträge tatsächlich revidieren, bedeute das »Krieg«, zitiert das Wall Street Journal den Manager eines Energiekonzerns. Die beiden Projekte, Sachalin-1 und -2, gelten im Kreml als strategisch wichtig, weil sie unweit von energiehungrigen Volkswirtschaften wie China, Indien und Japan liegen; Gazprom hat bereits Interesse an den Projekten bekundet. Im Juni 2006 werden Pläne bekannt für ein Gesetz, das Ausländern die Mehrheitsbeteiligung an wichtigen russischen Öl- und Gasfeldern generell verbieten soll.
Angesichts drohender Vertragsbrüche und Skandale wie der Zwangsversteigerung der Yukos-Tochter Yuganskneftegas überlegen sich westliche Ölkonzerne mehrmals, ob sie in ihre Produktion in Russland investieren wollen, und bringen ihr Geld lieber im Ausland in Sicherheit. Die Arbeit im Ölgeschäft sei so gefährlich geworden wie das Dealen mit Drogen, schreibt Russki Newsweek im Hinblick auf die Yukos-Affäre. In Wirklichkeit gehe es dem Kreml gar nicht darum, ob eine Firma staatlich sei oder nicht, zitiert das Blatt einen hochrangigen Gesprächspartner: »Es geht darum, wie die Geldströme zu lenken sind, in Richtung Präsidentschaftswahl und ferne Zukunft.«
Experten klagen, dass sich unlogische, undurchdachte Entscheidungen und Korruption häufen, seit aufgrund der Verstaatlichung nun Beamte statt Manager in den Konzernzentralen sitzen. So zahle die Yukos-Tochter Yuganskneftegas nach dem Wechsel zum staatlichen Rosneft-Konzern das Zehnfache für ihre Einkäufe, lässt der inhaftierte Michail Chodorkowski über seine Anwälte verkünden und deutet damit einen Korruptionsverdacht an.
Fachleute warnen vor einer »Venezualisierung« Russlands: In dem ölreichen südamerikanischen Staat sank das Bruttoinlandsprodukt infolge der Verstaatlichungen von 1977 bis heute um 40 Prozent. »Solange die Energiekonzerne vom Staat kontrolliert werden, werden Gas und Strom als politische Waffe genutzt«, warnt der frühere Präsidentenberater Andrej Illarionow. Der Präsident würde das sicher anders ausdrücken. Mit Öl und Gas sei es wie mit Süßigkeiten, sagte Putin am Rande des EU-Russland-Gipfels im Mai 2006, wo es um Energielieferungen nach Europa ging, vor russischen Journalisten: »Man kann das leicht verstehen, wenn man an die Kindheit zurückdenkt. Stell dir vor, du gehst in den Hof, hast ein Bonbon in der Hand, da sagt dir jemand: ›Gib das Bonbon her‹. Du hältst es ganz fest in der Hand und sagst: ›Was bekomme ich dafür?‹ Genauso wollen wir wissen [von Europa]: Was bekommen wir von euch?«
Auf dem Hinterhof in Sankt Petersburg lernte der kleine Wolodja Putin, dass nur der Starke Recht hat. Jahre später, im Kreml angekommen, musste er feststellen, dass Russland nicht stark war.
Nach der Geiseltragödie in Beslan trat Wladimir Putin 2004 schockiert vor die Fernsehkameras: »Wir haben Schwäche gezeigt. Und Schwache werden geschlagen.« Weder Russlands Armee noch seine Wissenschaft oder Wirtschaft können das Land auf absehbare Zeit stark genug machen, um zu einem bestimmenden Machtfaktor in der Weltpolitik zu werden. Wladimir Putin hat nur eine einzige Waffe im Kampf um Stärke und eine Weltmachtposition: die gewaltigen Energievorkommen Russlands.
Den vorherigen, dreißigsten Teil – Energie statt Raketen – finden Sie hier.
Den ersten Text der Buchveröffentlichung finden Sie hier.
Geheim-Urteil gegen die AfD: Der Staat brandmarkt – aber die Begründung dafür verrät er uns nicht
CDU unterschreibt ihr Ende – Koalitionsvertrag macht sie endgültig zu rot-grünem Erfüllungsgehilfen
„UN-fähig“ in New York: Wie Merz Baerbock peinlich nach oben rettet – und was dahinter steckt
Bild:
Mehr zu diesem Thema auf reitschuster.de

Chinesischer Flirt mit Nebenwirkungen
Als Russland und China eine geopolitische „Ehe“ eingingen, warnten liberale Kritiker: Moskau riskiere, zum Juniorpartner und Rohstofflager Chinas zu werden. Die Folgen dieser Partnerschaft zeigten sich schnell.

Die faschistische Gefahr
Die russische Regierung inszeniert sich als antifaschistische Kraft, doch Kritiker sehen Nationalismus, Intoleranz und Gewalt, die Minderheiten unterdrücken und die Demokratie gefährden.

Der kaukasische Teufelskreis
Die düstere Realität des russischen Kaukasus: Spannungen und Gewalt prägen das tägliche Leben in Stawropol und Naltschik. Willkommen in einer Welt am Rande des Abgrunds.

Arme Armee
Ein Wehrpflichtiger, der sich selbst verstümmelt, um dem Militär zu entkommen, offenbart dunkle Geheimnisse der russischen Armee. Hinter der Fassade von Ehre und Patriotismus lauern Gewalt und Misshandlung.

Exportschlager Mafia
Ein Diebstahl führt zu unerwarteten Enthüllungen: Die Geschichte zeigt, wie tief verwurzelt die Verflechtungen zwischen Russlands Behörden und der organisierten Kriminalität sind. Ein Blick hinter die Kulissen.
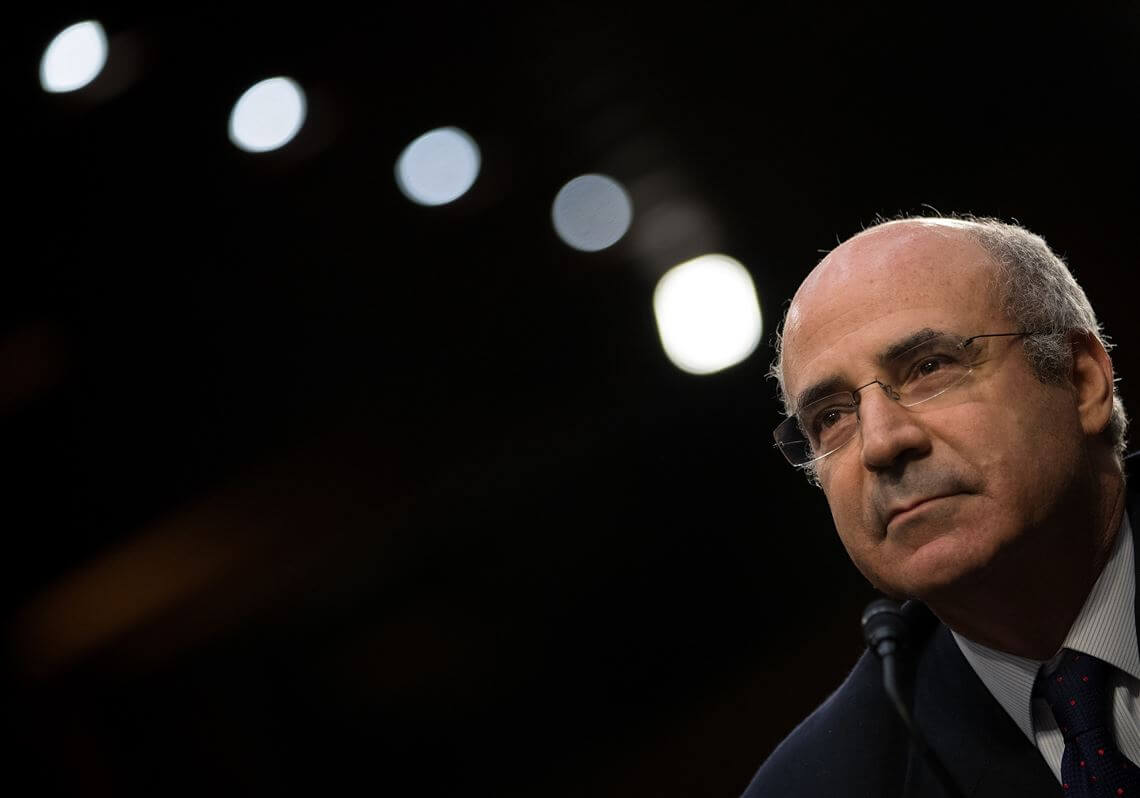
Geschäfte ohne Gewähr
William F. Browder, einst Kreml-treuer Investor, wurde über Nacht zur unerwünschten Person in Russland. Aus dem größten ausländischen Investoren wurde ein Staatsfeind – ein Lehrstück über Loyalität und Willkür.

„Call-Girls“ gegen Yukos
Der Yukos-Skandal war der Höhepunkt im Interessenkonflikt zwischen Apparatschiks und Oligarchen. Chodorkowski verstieß gegen alle Regeln, die Putin für die Superreichen eingeführt hat.

Feinde und Verräter
Der Mord an dem abtrünnigen FSB-Agenten Litwinenko mit hoch radioaktivem Polonium mitten in London erschüttertere die Welt. Der Mörder ist heute Duma-Abgeordneter. Die Spuren führen direkt in den Kreml.

Scheinwelt auf der Mattscheibe
„Die Medien in Russland haben aufgehört, ein Platz für den Meinungsaustausch und öffentliche Debatten zu sein“, klagten Kreml-Kritiker 2005. Moskau war damit Vorläufer für das, was wir inzwischen hier erleben.

Zynismus statt Marxismus
Für einen echten Demokraten wie ihn gebe es „nach dem Tod von Mahatma Gandhi niemanden mehr, mit dem man sprechen kann“, sagte Putin einst. Um zu verstehen, wie er das meint, muss man in die Geschichte schauen.

Farce statt Wahlen
Die Arbeit beim KGB ist geheimnisumwittert. Doch einmal erzählte Putin von einer der KGB-Aktionen – einer „doppelten Kranzniederlegung“. Sie ist geradezu sinnbildlich für Putins heutige Politik in Russland.