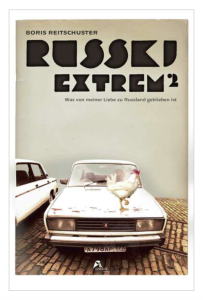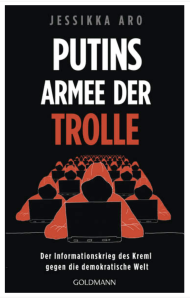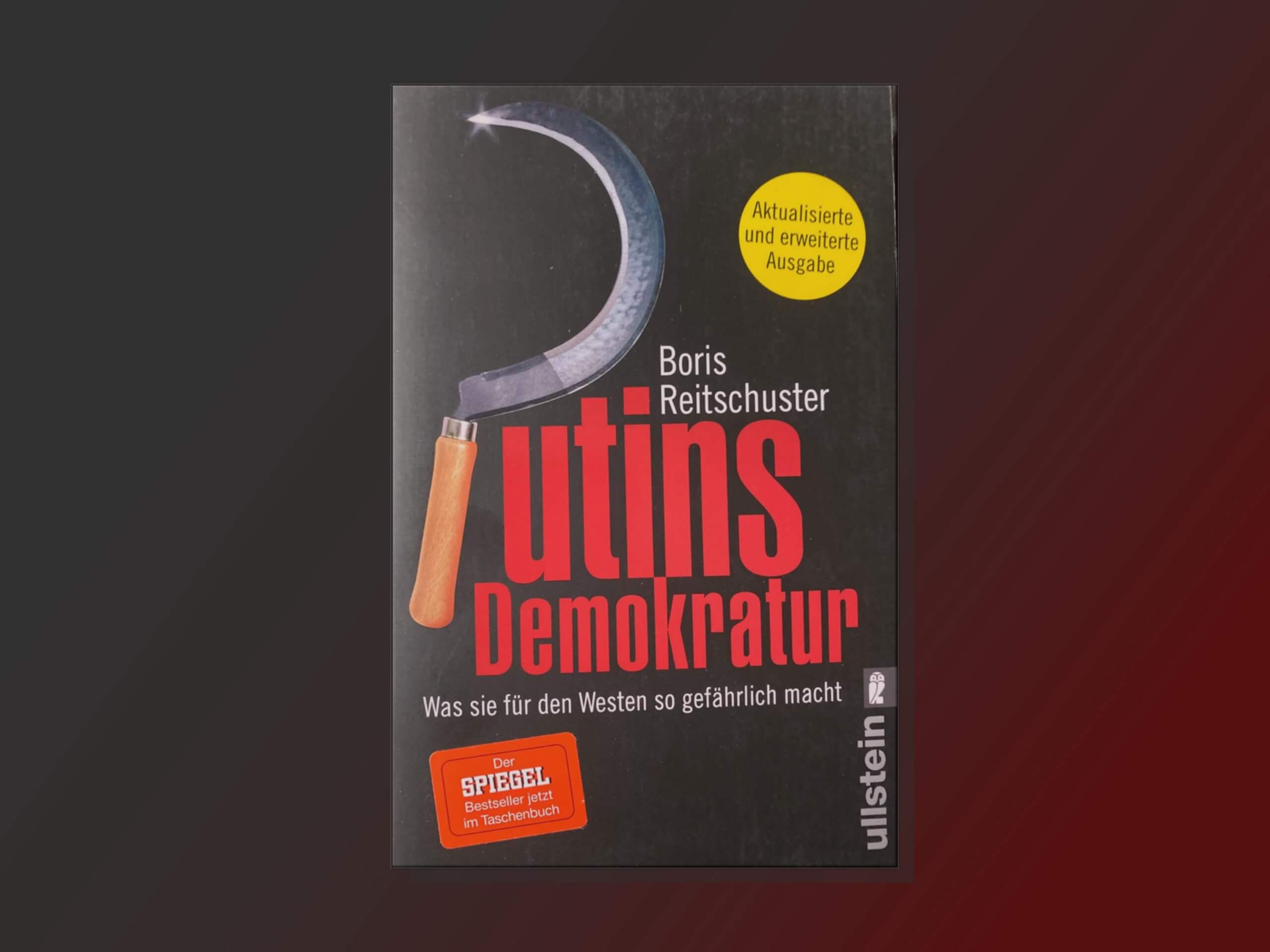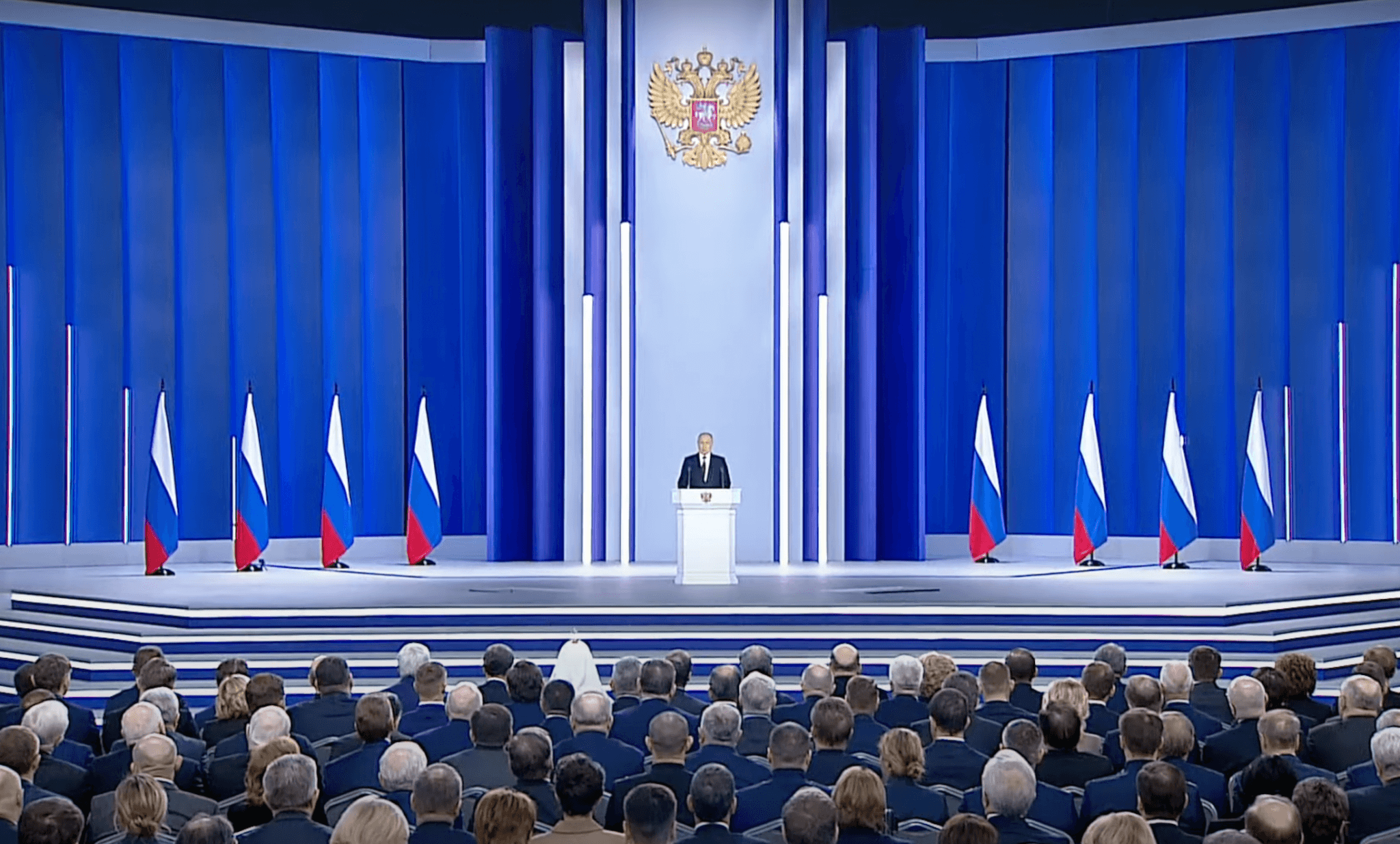Lesen Sie heute Teil 8 von „Putins Demokratur“. Warum ich Buch hier auf meiner Seite veröffentliche, können Sie hier in meiner Einleitung zum ersten Beitrag finden.
Es ist ein armseliges Aufgebot, das die Staatsmacht in den Kampf schickt. Die Sonne brennt auf den Asphalt, Staub beißt in den Augen. Stundenlang. Weil der Angreifer Verspätung hat. Als er endlich anrückt, werden Aufrufe zur Fahnenflucht laut: »Mama, ich habe Durst und bin müde. Wann darf ich endlich heim?«, klagt eine der Frontkämpferinnen. Sie trägt eine kurze Hose, einen Zopf und eine Zahnspange. Die Staatsmacht hat Erstklässler in die Schlacht geschickt. Ausgerechnet hier, nur eine halbe Autostunde von Beslan entfernt, vor dem Kulturpalast der Metallarbeiter in Wladikawkas, im Juni 2005. Die Kinder sind die Bauern in einer Schachpartie der anderen Art. Der Angreifer: Garri Kasparow, der beste Schachspieler aller Zeiten. Heute will er ganz Russland zu seinem Spielfeld machen. Doch diesmal ist der Mann, der 15 Jahre lang Weltmeister war, der Außenseiter. Früher trieb oft schon sein durchdringender Blick Gegnern den Angstschweiß auf die Stirn. Seinem neuen Widersacher kann der Mann mit den buschigen Augenbrauen nicht mal in die Augen sehen: Er sitzt hinter riesigen Ziegelmauern im Kreml und nimmt ihn nicht wahr. Oder tut vielleicht nur so. Garri Kasparow tritt gegen Wladimir Putin an. Es ist die schwerste Partie seines Lebens.
Für einen Moment huscht ein Lächeln über Kasparows müdes Gesicht, als er vor dem Stahlarbeiter-Palast aus dem rostigen Kleinbus steigt, als er all die Kinder sieht und die Musik hört, die blechern aus den Lautsprechern donnert. Früher haben sie oft Musik gespielt und Kinder antreten lassen, wenn er anreiste. Zu seinen Ehren. Und so scheint Kasparow erst nach ein paar Sekunden aufzugehen, dass die Kinder und die Musik diesmal von seinem Gegner bestellt wurden. Um ihn in Schach zu halten.
Mit solch unerwarteten Zügen attackiert die Staatsmacht den 42-Jährigen mit der Nase eines Boxers und einem Gehirn wie ein Rechenzentrum ständig, seit er im März 2005 überraschend seine Schachkarriere beendete und ankündigte, dass er von nun an nur noch den König im Kreml matt setzen wolle. Das Geiseldrama von Beslan war sein politisches Erweckungserlebnis, sagt er.
Seit Monaten reist Kasparow, der es mit dem königlichen Spiel zu einem Vermögen gebracht hat, mit einem Tross von Beratern und Leibwächtern durch Russlands Regionen, um Anhänger für seine neu gegründete »Vereinigte Bürgerfront« zu gewinnen. Finanziert wird Kasparows vorgezogener Wahlkampf von Unternehmern, die aus Angst anonym bleiben wollen: Leute aus dem Yukos-Konzern stünden hinter ihm, glauben seine Gegner. Ausgerechnet Kasparow, der die Schachwelt gespalten hat, will die chronisch zerstrittene Opposition einen: »Rechts, links, Kommunist oder Nationalist, das darf in diesen Tagen keine Rolle spielen. Solange es keine freien Wahlen gibt in Russland, müssen alle Aufrichtigen miteinander statt gegeneinander kämpfen – den Meinungsstreit um die richtige Richtung können wir beginnen, wenn es wieder faire Spielregeln gibt.«
Kasparow muss sich sein neues Spiel wohl anders vorgestellt haben. Damals, im Jahr 1985, als er dem Breschnew-Liebling Anatoli Karpow im Tschaikowski-Saal in Moskau die Schachkrone abnahm, mussten sich die Menschen die Eintrittstickets in endlosen Warteschlangen buchstäblich stundenlang erstehen. Heute kommt oft nur eine Handvoll Mutiger, wenn er sich ankündigt. Damals wurde Kasparow zum Symbol einer Generation, zu einem Aushängeschild für die Perestroika. Bei den schachbegeisterten Russen ist er bis heute so beliebt wie Beckenbauer in Deutschland. Aber er gilt auch als Rebell seiner Zunft, als egomanischer Chaot. Heute wirkt er einsam und fast ein bisschen fehl am Platz auf dem Gehsteig vor dem Kulturpalast in Wladikawkas. Am Schachbrett zwang Kasparow seine Gegner mit atemberaubenden Kombinationen in die Knie. Doch in seiner neuen Partie hilft ihm sein Intellekt wenig. »Meine Widersacher halten sich an keine Regel«, klagt der etwas zerknautscht wirkende Champion bitter und streckt die Hände zum Himmel, als bitte er um göttlichen Beistand: »Es ist, als ob dein Gegner die Schachfiguren nicht auf dem Brett zieht, sondern mit ihnen auf dich einschlägt.«
Kasparows Reisen gleichen absurdem Theater. Seine Fahrt durch den Kaukasus ist ein grotesker Hindernislauf durch das neue Russland. Wo immer das Flugzeug des Champions landen will, sind plötzlich Steine oder Kühe auf der Landebahn, beginnen plötzlich völlig unerwartet Reparaturarbeiten. So verbringt Kasparow die meiste Zeit mit Warten. In den Sälen, in denen er auftreten soll, fällt entweder der Strom aus oder die Behörden entdecken plötzlich irgendwelche Baumängel und müssen die Räume dringend sperren – oder es kommt zu einem Wasserrohrbruch wie in einer Bibliothek in Rostow am Don, wo der Zeitpunkt der Havarie schon vorab auf einem Warnschild stand und sich der »Rohrbruch« auf einen eigens angebrachten Schlauch beschränkte, aus dem ein Rinnsaal auf den Gehsteig tröpfelte. Auf Schritt und Tritt wird Kasparow von Mitarbeitern des FSB verfolgt, die kein Geheimnis aus ihrer Anwesenheit machen. In Wladikawkas erkundigen sie sich bei Kasparows Mitarbeiter nach dem weiteren Programm: »Dürfen wir schon heimgehen oder macht ihr noch was?«
Die Medien boykottieren Kasparow. Entweder verschweigen sie seinen Besuch, oder sie kürzen seine Aussagen so zusammen, dass nur vom Schach die Rede ist. In fast allen Regionen kommt es zu Szenen wie in Ulan-Ude, der Hauptstadt von Burjatien an der Grenze zur Mongolei. Um Fassung ringend, erklärt der Moderator einer Talkshow kurz vor der Sendung seinem Gast Kasparow, er dürfe nicht live auf Sendung, das sei eine Anweisung von oben: »Sonst bin ich meinen Job los!«
In Stawropol, der Heimat Michail Gorbatschows, kommen Kasparows Gastgeber viel zu spät zum Flughafen, weil die Verkehrspolizei sie endlos kontrolliert. Die Stadtverwaltung verbietet dem Hotel, in dem Kasparow Zimmer reserviert hat, ihn einzuquartieren. Auch die anderen Hotels dürfen ihn nicht aufnehmen, überall ist angeblich alles ausgebucht – aber nur für Kasparow und seine Begleiter. Eine Reservierungsanfrage auf den Namen »Reitschuster plus fünf Begleiter« wurde bei den gleichen Häusern problemlos akzeptiert. Alle drei gemieteten und bezahlten Säle, in denen Kasparow sprechen soll, sind plötzlich geschlossen. Ein Treffen mit der Presse muss gestrichen werden, weil in dem dafür vorgesehenen Restaurant der Strom ausfällt – die Kühlschränke und Fernseher jedoch laufen einwandfrei. Die Chefkellnerin drängt Kasparows Begleiter aus dem Speisesaal: »Hauen Sie bloß ab, in Gottes Namen, sonst bekomme ich die größten Unannehmlichkeiten.« Sie nimmt nicht mal das Geld für die Getränke. Am Eingang zu dem Restaurant haben zwei Milizionäre Stellung bezogen und lassen niemanden hinein.
Einen Straßenzug weiter stehen Ordnungshüter bei einer Gruppe älterer Männer und Frauen mit Spruchbändern, auf denen steht: »Wir lassen nichts auf Putin kommen.« Ständig sprechen sie in ihre Funkgeräte. Als Kasparow das Hotel verlässt und weiterfährt, geben die Milizionäre der Gruppe ein Zeichen – sie rollen die Spruchbänder ein und gehen. Am Abend platzt ein Treffen mit Geschäftsleuten. Das Hotel quartiert Kasparow doch noch ein, nachdem er in Telefonaten so getan hat, als wolle er auf dem Zentralplatz der Stadt ein Zelt aufschlagen. Offenbar hat die Aussicht auf einen öffentlichkeitswirksam im Freien campierenden Weltmeister die Geheimdienstler, die seine Telefonate abhörten, mehr erschreckt als ein Hotelgast Kasparow. Spät in der Nacht schleicht sich eine der eingeladenen Geschäftsfrauen in die Hotellobby. »Wir wollten Sie sehen«, flüstert die Unternehmerin ängstlich: »Aber wir haben Drohbriefe unter der Wohnungstür bekommen, dass es Ärger gibt, wenn wir zu Ihnen gehen.«
‘Jetzt habe ich die Angst besiegt‘
In Machatschkala, der Hauptstadt von Dagestan am Kaspischen Meer, bittet der Direktor der örtlichen Schachschule den Champion händeringend, als Ehrengast zur Siegerehrung eines Kinderturniers zu erscheinen. Am nächsten Tag schickt er ihn jedoch mit einer falschen Adresse ans andere Ende der Stadt – den Kindern erzählt er, der Champion habe sie sitzen lassen. Von Eltern informiert, fährt Kasparow dennoch zu der Schachschule. Der Haupteingang ist verriegelt. Eltern öffnen dem Exweltmeister von innen den Hintereingang. Die Kinder jubeln, schreien vor Begeisterung. Der Direktor hat sich in seinem Kabinett verbarrikadiert. Als er den Jubel hört, kommt er heraus: Die Regierung habe ihm mit der Entlassung gedroht, wenn er den Großmeister zu seinen Schülern lasse, entschuldigt er sich: »Aber jetzt sind Sie da, jetzt ist mir das egal, jetzt will ich mich freuen, dass Sie da sind! Jetzt habe ich die Angst besiegt.«
Im Kulturpalast in Wladikawkas wollte sich der Exweltmeister eigentlich mit den Opfern des Massakers von Beslan treffen. Doch wie so oft sperrten ihn die Behörden aus, setzten den Vermieter unter Druck. Diesmal ist offiziell der Vorhang kaputt. Die Tänzer, die gerade noch im Saal übten, wissen davon nichts. Als Kasparow ankündigt, das geplante Treffen auf den öffentlichen Platz vor den Palast zu verlegen, organisieren die städtischen Behörden eilig ein Kinderfest – offenbar um Kasparow zuvorzukommen und ihn zu übertönen. Mit tiefer, heiserer Stimme brüllt die Schachlegende gegen ein Lied über die Bremer Stadtmusikanten an: »Das ist der Gipfel des Zynismus, dass sich die Staatsmacht hinter Kindern versteckt, hier, bei Beslan.«
Kasparow ist umringt von Frauen in schwarzen Gewändern und mit roten Augen, die wie lebende Mahnmäler wirken: Es sind Hinterbliebene von Beslan-Opfern. Sie sind überzeugt, dass die Behörden bis heute die Wahrheit über das Massaker mit mehr als 300 Toten vertuschen. Von Kasparow erhoffen sie Aufklärung. Viele glauben, dass die Sicherheitskräfte die Explosion in der Turnhalle und damit den blutigen Sturm auf die Schule selbst auslösten, um weitere Verhandlungen mit den Terroristen zu verhindern – just in dem Moment, als Tschetschenen-Führer Aslan Maschadow sich aus dem Untergrund als Vermittler anbot.
Im Juli 2007 veröffentlichen Angehörige der Opfer ein Video des Geiseldramas – nach den Bildern haben nicht die Geiselnehmer, sondern die Sicherheitskräfte das Massaker im September 2004 ausgelöst. Demnach schossen die Beamten mit Granaten auf das von den Aufständischen besetzte Schulgebäude in der Stadt Beslan.
Eine junge Frau läuft wütend auf einen der fünf Leibwächter Kasparows zu. Offenbar verwechselt sie ihn wegen seiner reichlichen Muskelausstattung mit einem der vielen Geheimdienstler auf dem Platz: »Wie viele Stunden wollen Sie unsere Kinder noch hier festhalten? Die sind doch fertig von der Hitze, können kaum noch stehen.« Ein Milizionär drängt die Frau hastig ab.
Die schwarz gekleideten Beslan-Hinterbliebenen erzählen, dass die Behörden vertuschen und versuchen, sie einzuschüchtern. Dass nachts Männer an ihre Türen klopfen und sie warnen, nicht mit Journalisten zu sprechen. Wenn sie es doch tun, kommen diese Männer wieder und verhören selbst kleine Kinder. Sie haben Angst vor ihrem eigenen Staat, sagen sie. Und sie hoffen auf Kasparow: »Helfen Sie uns, damit wir die Wahrheit erfahren, damit die Schuldigen bestraft werden. Damit sich so etwas nicht wiederholt. Nur das gibt unserem Leben noch Sinn, wenn unsere Kinder nicht ganz umsonst gestorben sind, wenn man wenigstens die nötigen Lehren zieht und sich so etwas nie wiederholt.«
‘Als ob der Tod unserer Kinder in der Schule noch nicht genug wäre!‘
Mit einem Mal zucke ich zusammen: Ich spüre einen Schlag auf der Schulter. Ein Ei prallt von mir ab und platscht auf den Asphalt. Ein Querschläger – es hätte Kasparow treffen sollen, der ein paar Meter weiter mit seinen Anhängern spricht. Nur zwei Sprünge von mir holt einer der Eierwerfer, ein Halbwüchsiger, zu einer erneuten Attacke aus. Ich falle ihm in den Arm. Er starrt auf den Boden, wehrt sich nicht; er wirkt geistig abwesend, als hätte er Drogen genommen. Genau in diesem Moment rennen die Milizionäre, die gerade noch völlig untätig die Eier-Attacke beobachtet haben, auf mich zu. »Hier, das ist der Übeltäter«, rufe ich ihnen zu und bin überzeugt, dass sie sich den jungen Mann gleich schnappen werden. Doch die Ordnungshüter stürzen sich auf mich. »Lass sofort den Jungen los!«, schreien sie mich an, als wäre ich hier derjenige, der Unrecht getan hat. »Aber das ist doch der Eierwerfer! Sie müssen ihn festhalten, nicht mich«, sage ich. Der Halbwüchsige läuft davon, die Milizionäre sehen seelenruhig zu. Ich reiße mich los und renne dem Eierwerfer hinterher. Dabei hole ich meine Kamera aus der Tasche und versuche, den Rowdy zu fotografieren. Ein Mann in Zivil rennt auf mich zu, zerrt mich am Arm und versucht, mich in den Polizeigriff zu bekommen. »Ich will den Täter fotografieren und Beweise sichern, lassen Sie mich los«, wehre ich mich. »Die Miliz beschützt die Täter«, schreit eine der Frauen in den Trauergewändern fast hysterisch: »Als ob der Tod unserer Kinder in der Schule noch nicht genug wäre!«
»Du Hure, was bildest du dir ein, wer du bist, du wirst jetzt gleich was erleben«, brüllt der Mann in Zivil mich an. Sofort kommt ihm ein Milizionär zur Hilfe, hält mich am anderen Arm fest und reißt mir die Kamera aus der Hand. Ein paar Meter weiter läuft der Eierwerfer seelenruhig durch die Reihen der Miliz davon.
»Das ist Widerstand gegen die Staatsgewalt«, herrscht mich der Mann in Zivil an. »Welche Staatsgewalt? Sind Sie Zivilfahnder? Oder vom Geheimdienst?«, hätte ich eigentlich zurückfragen sollen. »Was Sie da tun, ist Strafvereitelung im Amt und Behinderung der Presse«, sage ich stattdessen und kann mit Mühe meine rechte Hand losmachen und meinen Akkreditierungsausweis – ausgestellt vom russischen Außenministerium – zücken. Doch das Papier macht wenig Eindruck.
Ein Mann in einem weinroten Hemd, der sich gerade noch etwas abseits gehalten hat, kommt plötzlich auf mich zu und schreit mich unflätig an: »Geh zurück nach Deutschland und kommandier dort!«, brüllt er. Wie sich später herausstellt, handelt es sich um den Sprecher des nordossetischen Innenministeriums, zuständig für Kontaktpflege und Information der Presse.
Als die Eierwerfer etwas später vor den Augen der Ordnungshüter eine neue Attacke auf Kasparow beginnen, ballt der Champion die Hände zur Faust, zieht die Augenbrauen zu einem einzigen breiten, schwarzen Strich in seinem Gesicht zusammen und tut das, was schon am Schachbrett immer seine Stärke war: Er holt zum Gegenschlag aus – diesmal verbal: »Dieses Regime ist kriminell. Sie glauben, die Menschen seien dazu da, Ihnen zu dienen, und es geht Ihnen nur um persönliche Bereicherung«, schreit Kasparow, und seine Stimme verliert allmählich den Kampf gegen die Kinderlieder. »Der Kaukasus ist ein Pulverfass, das Putin absichtlich gefüllt hat, für seinen Wahlkampf. Das ist die Quelle des Terrorismus.« Kasparows Stimme versagt, er ringt nach Luft: »Wie Lenin und Stalin hetzen Putin und seine KGBler die Menschen gegeneinander auf, damit sie die eigentlichen Probleme nicht sehen. Nur indem sie Krieg schüren und Blut vergießen, halten sie sich an der Macht.«
Wieder fliegen Eier. Und Tomaten
Zwanzig Kilometer weiter, in Beslan selbst, ergeht es Kasparow nicht besser. Der Raum, den er angemietet hat, bleibt versperrt – wegen einer Kinder-Kinovorführung. Drei unrasierte, glatzköpfige Männer mit roten Backen und Mienen wie auf Fahndungsplakaten steigen gemeinsam mit Milizionären aus einem Jeep, springen auf Kasparow zu und schreien ihn an: »Wo warst du, als die Terroristen hier waren? Warum machst du Politik mit dem Tod von Kindern? Warum besudelst du dich mit Blut?« Immer wieder kommt es zu Handgreiflichkeiten, die Uniformierten stoßen die Mütter verstorbener Geiseln weg. Die Frauen schreien, weinen, einige geraten fast in Panik. »Das ist alles, was uns dieses Regime zu sagen hat, nur so kann es mit uns sprechen, das sind die Methoden von 1917«, erregt sich Kasparow in Anspielung auf die Oktoberrevolution: »Mit dem Unterschied, dass sie heute dick gefüllte Bankkonten in der Schweiz haben. Seit 80 Jahren tun sie nichts als Feindbilder aufzubauen, Hass zu schüren, um von ihren eigenen Taten abzulenken.« Gegenüber steht Lenin auf einem abbröckelnden Fundament. »Sie haben einen großen Nachteil, Sie sind ein anständiger Mensch, und deshalb sind Sie denen nicht gewachsen«, ruft eine schwarz gekleidete Frau Kasparow zu: »Die haben vor allem Angst. Selbst vor uns, vor schwachen, trauernden Frauen.« Doch die Glatzköpfe übertönen die Schreie der Frauen. Wieder fliegen Eier. Und Tomaten.
Eine Frau fasst Kasparow an der Hand, spricht, ja schreit mit heiserer, sich ständig überschlagender Stimme: »Garri, wir sind mit Ihnen! Sechs Verwandte von mir sind gestorben, zwei wurden zu Krüppeln, und jetzt wird hier so ein Schauspiel aufgeführt, das ist unwürdig. Für uns Kaukasier steht die Gastfreundschaft über allem, was hier aufgeführt wird, ist eine Schande für uns alle!« Sie wischt sich mit einem Taschentuch die Tränen aus den Augen. Zwei andere Frauen ziehen Kasparow am Arm zur Seite: »Hier werden wir keinen Frieden finden, lassen Sie uns hinübergehen, zur Ruine der Schule, das ist ein heiliger Ort, da starben unsere Kinder, da werden sich diese Provokateure nicht hintrauen, vor so einer Sünde schrecken selbst sie zurück, das ist der einzige Ort, an dem wir noch sicher sind.«
Tatsächlich bleiben die Glatzköpfe und die Uniformierten 200 Meter vor der Ruine der Beslaner Schule stehen, als seien sie an eine unsichtbare Mauer gestoßen. Das Gebäude ist ein Schlachtfeld. »Warum hält man bis heute geheim, wer damals den Befehl zum Schießen gegeben hat? Warum wurde abgestritten, dass mit Panzern und Flammenwerfern auf die Schule geschossen wurde? Wer gab den Befehl?«, fragt Kasparow. Neben ihm steht Susanna Dudijewa und starrt ins Leere. Alles um sie herum sei für sie unwichtig, seit ihr zwölfjähriger Sohn in der Schule starb, sagt sie. Ihr schwarzes Kopftuch hat sie fast bis zu den Augenbrauen in die Stirn gezogen: »Solange die Wahrheit über Beslan nicht ans Licht kommt, wird der Terror kein Ende nehmen.« Vor den Männern in Moskau habe sie weder Angst noch Respekt, beteuert sie: »Was ist schon ein Amt? Wenn du dein Kind siehst, verbrannt wie ein Stück Holz, wenn du nicht mehr unterscheiden kannst, ob es ein Mädchen war oder ein Junge, dann verstehst du, dass kein Amt dieser Welt etwas zu bedeuten hat.«
Direkt vor der Turnhalle, wo die meisten Opfer ums Leben kamen, zupft ein zahnloser alter Mann mit dreckiger, viel zu weiter Hose den Schachmeister am Ärmel: »Ich hoffe, Sie haben gute Bewacher, denn Sie leben gefährlich«, zischt er und blickt sich ängstlich in alle Richtungen um: »Ich saß unter Stalin im Lager. Sie haben meinen Respekt! Lieber einen Tag leben wie ein Löwe als das ganze Leben wie ein Hase vegetieren.«
Am nächsten Tag berichten russische Medien, Kasparow habe versucht, aus der Tragödie von Beslan, mit dem Blut der Opfer, billig politisches Kapital zu schlagen und die Hinterbliebenen auszunutzen. Doch die Menschen in Nordossetien hätten das nicht mit sich machen lassen, und der Volkszorn habe sich spontan in Form von Eierwürfen entladen. »Niemals in seinem Leben hat der Schachkönig so eine Erniedrigung erlebt«, schreibt die staatliche Nachrichtenagentur RIA Nowosti: »Ohne diese Form rechtfertigen zu wollen, muss man eingestehen, dass die Emotionen der Eierwerfer nachvollziehbar sind.« Durch die Reise nach Beslan habe Kasparow jene moralische Grenze überschritten, die Politiker von Demagogen trenne, denen alle Mittel recht seien: »Mit den Gefühlen der Opfer zu spielen, absichtlich die Glut im Kaukasus anzufachen, das ist eine schmutzige Sache. Ich denke, genau dafür hat Kasparow sein Rührei serviert bekommen.«
Die Fortsetzung finden Sie in Kürze hier auf meiner Seite – den zweiten Teil des Kapitels „Militarisierung der Macht“.
Die Fortsetzung finden Sie in Kürze hier auf meiner Seite: Farce statt Wahlen.
Den vorherigen, siebten Teil – Militarisierung der Macht – finden Sie hier (Teil 2).
Den sechsten Teil – Militarisierung der Macht – finden Sie hier (Teil 1).
Den fünften Teil – Putins bombiger Auftakt – finden Sie hier.
Den vierten Teil – Die Herrschaft der Exkremente – finden Sie hier.
Den dritten Teil – Mit Stalin in die Zukunft – die verratene Revolution – finden Sie hier.
Den zweiten Teil – „Der Gas-Schock – Moskaus Warnschuss“ – finden Sie hier.
Den ersten Text der Buchveröffentlichung finden Sie hier.
Ein Blick auf Nordkorea: (M)eine erschütternde Reise in die Zukunft – in den grünen (Alb-)traum
Bild: Screenshot Youtube-Video Maxim Kaz (Максим Кац)