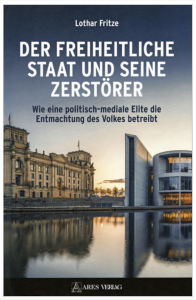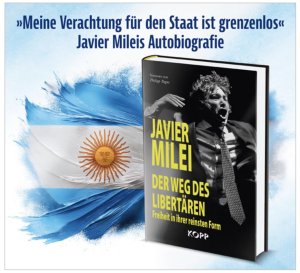Ein Gastbeitrag von Thomas Rießinger
Viel hat er geredet, der neue Bundeskanzler, als er in seiner ersten Regierungserklärung noch einmal den Redenschreiber seines Vorgängers Olaf Scholz zu Wort kommen ließ und schon dadurch zeigte, was von seinen Ankündigungen eines Politikwechsels zu halten ist. Vor allem die Außenpolitik hat es ihm angetan, selbstverständlich insbesondere der Krieg in der Ukraine, weil es offenbar mehr Spaß macht, mit den europäischen Kollegen eine muntere Bahnreise nach Kiew zu unternehmen, als sich um die drängenden Probleme zu Hause zu kümmern, deren Lösung ihm angeblich so sehr am Herzen liegt.
Doch ich will ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen: Es war nicht nur die Außenpolitik, von der er sprach, auch die wirtschaftliche Lage Deutschlands fand Erwähnung. Bedauerlicherweise riss er alle eventuellen Brücken zu einer neuen Erstarkung der Wirtschaft nieder, indem er klarstellte: „An den deutschen und europäischen Klimazielen halten wir fest. Doch um sie zu erreichen, werden wir neue Wege einschlagen. Zentraler Baustein wird die CO2-Bepreisung – und damit ein marktwirtschaftlicher Ansatz, der Anreize setzt.“ Aber jede Art der CO2-Bepreisung ist nichts weiter als eine Ausplünderung der Bürger und ihrer Wirtschaft im Sinne einer keineswegs belegten Klimatheorie und ihrer Profiteure, und ob man die Ausplünderung marktwirtschaftlich verbrämt oder nicht, kann dem, der die Rechnung bezahlen muss, herzlich egal sein. Merz hat immerhin schon versprochen, dass alles teurer wird – nach der Bundestagswahl hat er das, nicht etwa vorher – und vermutlich erwartet er sogar Lob dafür, dass er wenigstens dieses Versprechen hält.
In jedem Fall weiß er genau, was not tut: „Was wir brauchen, ist nicht mehr und nicht weniger als eine gemeinsame Kraftanstrengung. Ich habe große Zuversicht, dass uns das in den nächsten Jahren gemeinsamen gelingen kann.“ Ja, so stellt er sich das vor. Wir alle müssen uns anstrengen, damit die Regierung immer mehr von unserem Geld verschleudern und den Ruin durch eine verfehlte Politik munter weiter treiben kann: Zu irgendetwas muss der Bürger schließlich gut sein, wenn er schon dazu neigt, zunehmend falsche Parteien zu wählen. „Wir müssen in diesem Land wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten“, hat er vor Kurzem geäußert, wogegen nichts zu sagen wäre, wenn er das auf sich und sein Kabinett bezogen hätte. Doch er meinte die Bürger, die Arbeitnehmer, die Selbstständigen, die mehr arbeiten müssen, damit sie noch mehr Steuern und Abgaben zahlen können, zur Rettung des Weltklimas, des Weltfriedens und der Koalitionsparteien.
Gibt es denn nicht auch Positives zu vermelden, was den Blick in die Zukunft etwas aufhellen könnte? Das gibt es, man findet es ein wenig versteckt mitten in der Merz’schen Regierungserklärung. „Schon sehr bald“, gab Merz zu wissen, „werden wir junge Menschen dabei unterstützen, für ihr Alter vorzusorgen und Verantwortung für ihre eigene Zukunft zu übernehmen – mit der sogenannten Frühstart-Rente, durch die bereits ab dem 6. Lebensjahr der Aufbau einer kapitalgedeckten individuellen Altersversorgung beginnt.“ Man freue sich nicht zu früh: der Begriff „Frühstart-Rente“ bezieht sich nicht auf einen möglichst frühen Start der Rente, am besten gleich nach der Schulzeit; so etwas bekommen nur Grünen-Politiker, die sich ohne nennenswerte Ausbildung in jungen Jahren in die Parlamente wählen und das Fehlen jeder Arbeitsleistung von den Steuerzahlern gut entlohnen lassen. Nein, die Menschen sollen früh, sehr früh schon damit beginnen, für ihre Altersversorgung zu sparen, weil sogar die Regierung gemerkt hat, dass die gesetzliche Rente früher oder später kollabieren muss – insbesondere wegen der freudig begrüßten Fachkräfte, die die Rentenkasse mit eher überschaubaren Beiträgen fördern, dafür aber im Rentenalter versorgt werden müssen.
Mit derartigen Details belastet sich Merz aber nicht, er darf es auch nicht, weil dann sein Vizekanzler böse schauen würde: Er begnügt sich mit der bloßen Ankündigung. Frühstart-Rente – was könnte damit wohl gemeint sein? Schon im April hat es uns die Tagesschau erklärt. „Konkret soll jedes Kind vom 6. bis zum 18. Lebensjahr, das eine Bildungseinrichtung in Deutschland besucht, ab dem 1. Januar 2026 pro Monat zehn Euro vom deutschen Staat bekommen. Dieses Geld soll in ein individuelles, kapitalgedecktes und privatwirtschaftlich organisiertes Altersvorsorgedepot fließen.“
Welch eine Wohltat für die Jugend! Zehn Euro soll der deutsche Staat – um genau zu sein: der deutsche Steuerzahler – jedem Kind, jedem Jugendliche bezahlen, Monat für Monat, Jahr für Jahr, sofern dieses Kind, dieser Jugendliche „eine Bildungseinrichtung in Deutschland besucht“. Ob auch Koranschulen oder Volkshochschulkurse über veganes Yoga diese Bedingung erfüllen, ist derzeit noch unklar.
Was bedeutet das konkret für die jungen Nutznießer? Man kann es sich so vorstellen: Pünktlich zum sechsten Geburtstag werden von staatlicher Seite zehn Euro auf ein für das Kind eingerichtetes Depot überwiesen, und das wiederholt sich jeden Monat, bis dann der 18. Geburtstag heranrückt und nichts mehr bezahlt wird. Zwölf Jahre lang wird also gefördert, erst mit Eintritt der Volljährigkeit endet die staatliche Zahlung. Und was erwartet dann den frischgebackenen Volljährigen, auf welches Vermögen darf er sich freuen?
Um das zu sehen, muss man ein wenig rechnen und ein wenig spekulieren. Zum Zweck des Rechnens mache ich mir das Leben etwas einfacher und gehe davon aus, dass nicht monatlich zehn Euro überwiesen werden, sondern zu jedem Geburtstag gleich die vollen 120 Euro eines Jahres, und das zwölfmal, vom sechsten bis zum siebzehnten Geburtstag. Für den Empfänger ist das etwas günstiger, wobei ich auf die Unterschiede im Ergebnis gleich noch zu sprechen komme, und vor allem ist es für den Leser übersichtlicher und leichter zu verstehen.
Versetzen wir uns also in die Lage des Sechsjährigen, der ein Altersvorsorgedepot allerdings nicht zu seinen vordringlichen Geburtstagswünschen zählen dürfte. Pünktlich zu seinem sechsten Geburtstag kommen die ersten 120 Euro und zum siebten Geburtstag dann die zweiten. Aber die ersten 120 lagen nicht einfach unter dem Kopfkissen, sondern im erwähnten Depot und haben dort Zinsen abgeworfen. Wie viele? Das ist eine gute Frage. Bei der Tagesschau-Erläuterung ging man davon aus, dass in eine spezielle Art von Aktiensparplan investiert wird, der sich einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 6% rühmen kann. Davon werde ich für den Anfang auch ausgehen, später werde ich das noch variieren. Die ersten 120 Euro werden also mit 6% verzinst, was im Laufe eines Jahres zu 7,20 Euro Zinsen führt. Zum siebten Geburtstag sind also aus 120 Euro 127,20 Euro geworden, auf die man noch die frische Zahlung von 120 Euro addieren muss. 247,20 Euro sind das Ergebnis. Und so geht das weiter, bis am siebzehnten Geburtstag die letzte Zahlung erfolgt und das bisher erreichte Kapital noch ein Jahr lang bis zum Eintritt der Volljährigkeit verzinst wird. Die Entwicklung kann man in der folgenden Tabelle sehen.
| Fonds-Entwicklung bei 6% | ||
| Geburtstag | Zahlung | Kapital |
| 6 | 120 | 120,00 |
| 7 | 120 | 247,20 |
| 8 | 120 | 382,03 |
| 9 | 120 | 524,95 |
| 10 | 120 | 676,45 |
| 11 | 120 | 837,04 |
| 12 | 120 | 1007,26 |
| 13 | 120 | 1187,70 |
| 14 | 120 | 1378,96 |
| 15 | 120 | 1581,70 |
| 16 | 120 | 1796,60 |
| 17 | 120 | 2024,39 |
| 18 | 0 | 2145,86 |
Im ursprünglichen Modell der monatlichen Zahlung, das man bei der Tagesschau präferiert, kommen nur 2101,50 Euro statt 2145,86 Euro heraus, was mit der jeweiligen Verzinsungsdauer der Beiträge zu tun hat, aber auf die Differenz von 44 Euro kommt es hier nicht an.
Über 2145,86 Euro kann sich also in meinem Modell der Muster-Volljährige freuen – und kann es doch nicht, in dreierlei Hinsicht. Denn erstens ist das Geld zwar für ihn gedacht, aber darüber verfügen darf er nicht. Erst beim Eintritt in das Rentenalter, also derzeit an seinem siebenundsechzigsten Geburtstag, darf er zugreifen, vorher nicht. Das könnte unter Umständen sein Interesse an der gewaltigen Summe und an weiteren Zahlungen aus eigener Tasche etwas schmälern, zumal Achtzehnjährige – wer wollte es ihnen verdenken – üblicherweise nicht allzu viele Stunden ihres Tages mit Gedanken an die Altersversorgung verbringen.
Zweitens setzt dieses Ergebnis eine recht optimistische Verzinsung von jährlichen 6% über 12 Jahre voraus. Man hat sich bei den Modellrechnungen hier an einem bestimmten Aktiensparplan orientiert, sollte aber nicht vergessen, dass das „Altersvorsorgedepot“ zwar privatwirtschaftlich organisiert sein soll, aber trotzdem staatlicher Kontrolle unterliegen dürfte, mit allen Widrigkeiten staatlicher Einflussnahme. Die Deutsche Bahn mit ihrer Neigung zu ständigem Versagen ist ein beredtes Beispiel. Selbst die so gern gerühmte gesetzliche Rentenversicherung wird nach einem Gutachten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung mit einer Rendite von etwa 3% gehandelt – wobei man bedenken muss, dass dieses Institut von Marcel Fratzscher geleitet wird, dem Christian Drosten der Ökonomie, der auch schon einmal behauptet hat, ein Flüchtling erwirtschafte spätestens nach sieben Jahren mehr, als er den Staat koste. Seine Prognosen und Berechnungen sind daher mit Vorsicht zu genießen. Und die einstmals stark beworbene Riester-Rente, ebenfalls ein staatlich gefördertes Produkt zur Altersversorgung, steht keineswegs besser da; man kann sich freuen, wenn man mit ihr eine Rendite von 2% erzielt.
Der optimistische Zinssatz von 6% könnte sich also als illusorisch erweisen. Rein rechnerisch macht das gar nichts, denn die oben aufgestellte Tabelle lässt sich auch für jeden beliebigen anderen Zinssatz füllen. Geht man beispielsweise von 4% statt 6% aus, dann werden zum Zeitpunkt der Volljährigkeit 1875 Euro zur Verfügung stehen, bei 3% sind es 1754, und wenn ich mich im Sinne der Riester-Rente für einen Zinssatz von 2% entscheide, dann bleiben dem neuen Volljährigen noch 1642 Euro nach 12 Jahren Wartezeit.
Das war das zweite Problem: Wir kennen den Zinssatz nicht und sollten ihn nach aller Erfahrung mit staatlich geförderten Anlageprodukten auch nicht zu hoch ansetzen. Aber das ist nicht alles. Denn 10 monatliche Euro im Jahr 2037 sind nicht das gleiche wie zehn Euro im Jahr 2026. Nominell schon, nach Kaufkraft nicht, da man leider mit dem unschönen Phänomen einer gewissen Inflationsrate rechnen muss. Betrachtet man die deutschen Inflationsraten von 1992 bis 2024, so stellt man fest, dass sowohl in den letzten zwölf Jahren, von 2013 bis 2024, die durchschnittliche Preissteigerung bei etwas über 2% lag; in dem längeren Zeitraum von 33 Jahren war sie etwas niedriger, aber immer noch knapp über 2%. Man riskiert also nicht allzu viel, wenn man auch für die Zukunft eine ähnliche Inflationsrate annimmt; mal ist sie niedriger, mal ist sie höher, aber so etwas gleicht sich bei längeren Zeiträumen aus. Sicher: das ist genauso spekulativ wie die angenommenen Renditen, aber Inflation ist real und man darf sie nicht außer Acht lassen.
Denn sie hat Auswirkungen auf die regelmäßigen Einzahlungen, die ich noch immer mit 120 Euro jährlich beziffere. 12 Jahre dauert es, vom sechsten bis zum achtzehnten Geburtstag, um die Einzahlungsphase zu beenden. Was zum sechsten Geburtstag 100 Euro kostete, wird ein Jahr später – natürlich im Mittel gerechnet – schon mit 102 Euro zu Buche schlagen, denn ich muss mit einer Preissteigerung von 2% rechnen. Wieder ein Jahr darauf sind es schon 104,40 Euro, weil auf den Vorjahrespreis erneut 2% aufgeschlagen werden müssen. Und so geht es weiter, 12 Jahre lang, und man kann leicht ausrechnen, dass man statt 100 Euro im ersten Jahr nun 126,82 Euro im letzten Jahr ausgeben muss, um die gleichen Waren zu erwerben. Geht man nun wieder zurück zu den 2145,86 Euro, die im optimistischen Szenario als Resultat nach 12 Jahren zu erwarten sind, dann stellt man fest, dass sie in anfänglichen Preisen nur noch 1692 Euro wert sind. Bei unterstellter Verzinsung von 3% landet man bei 1383 Euro, und mit einer Verzinsung von 2% erhält man inflationsbereinigte 1294 Euro.
Drei kleine Probleme sind also schon aufgetaucht: Der begünstigte Achtzehnjährige muss 49 Jahre lang auf sein Geld warten, die angenommenen Zinssätze sind alles andere als garantiert und die Preissteigerung vernichtet gnadenlos einen Teil des angesparten Geldes. Der Diskussion halber will ich aber davon ausgehen, dass der Besitzer einer seinem Zugriff unzugänglichen Summe sich mit 18 Jahren noch daran erinnert oder erinnert wird und sich nun überlegt, was er wohl damit anfangen könnte. Der Koalitionsvertrag verrät uns, dass der Vertrag „durch private Einzahlungen bis zu einem jährlichen Höchstbetrag weiter bespart werden“ kann, und zeigt damit wieder eine Neigung zu Dirigismus: Wenn schon jemand sparen will, dann soll man ihn auch sparen lassen und nicht mit staatlich festgelegten Höchstbeträgen gängeln, aber eine Regelung ohne Gängelung kann man sich in Koalitionskreisen wohl nicht vorstellen.
Da mich aber der Wert der rein staatlichen Leistungen für die Altersvorsorge interessiert, gehe ich nun davon aus, dass der Achtzehnjährige nichts weiter einzahlt und auf die Verzinsung der geschenkten Gelder hofft. Lang genug Zeit hat er dafür: Im Jahr 2026 ist er beispielsweise sechs Jahre alt geworden, 2038 wird er 18 sein, und die Rente mit 67 wird man ihm vielleicht – falls es dann noch eine Rente und einen deutschen Staat gibt – 2087 auszahlen, 49 Jahre später. All diese Jahre liegt sein Geld unverdrossen im Depot und steigert sich hoffentlich jährlich um die Zinsen, deren Satz wir nur spekulativ erahnen können. Den Betrag von 2087 auszurechnen, ist nicht schwer, sobald man sich für einen Zinssatz entschieden hat.
Um ein Beispiel zu geben, beginne ich wieder mit dem optimistischen Satz von 6%, der dazu führte, dass 2038, zum achtzehnten Geburtstag meines fiktiven Kandidaten, 2145,86 Euro zur Verfügung stehen. Bis zum neunzehnten Geburtstag muss man den Betrag um 6% erhöhen, den neuen Betrag dann bis zum zwanzigsten wieder um 6% und so weiter, zwar nicht bis in alle Ewigkeit, aber doch bis zum siebenundsechzigsten Geburtstag, an dem die letzte Verzinsung erfolgt. Neunundvierzig mal wird also verzinst, und schon mit einem üblichen Taschenrechner findet man, dass sich der angelegte Betrag im Lauf der Zeit auf 37.289,63 Euro erhöht. Das klingt beeindruckend, man sollte aber nicht vergessen, dass hier eine ausgesprochen gute Verzinsung vorausgesetzt wurde und dass im Verlauf der 49 Jahre auch die Inflation ein Wörtchen mitzureden hat. Rechnet man den Betrag bei zweiprozentiger Inflation wieder herunter auf das Preisniveau von 2038, so bleibt noch eine Kaufkraft von 14.131 Euro.
Die folgende Tabelle zeigt, den Stand des Kapitals zu Beginn der Auszahlungsphase, abhängig von den erreichten Zinssätzen, sowohl nominell als auch inflationsbereinigt. Auf die Angabe von Centbeträgen habe ich dabei verzichtet.
| Endkapital | ||||
| Zinssätze | 3% | 4% | 5% | 6% |
| Kapital | 7.466 | 12.814 | 21.903 | 37.290 |
| inflationsbereinigt | 2.829 | 4.956 | 8.300 | 14.131 |
Wie man sieht, nimmt sich der Endbetrag bei niedrigeren Zinssätzen keineswegs mehr überwältigend aus; bei 3% erreicht man zum Beispiel – in den Preisen von 2038 – gerade noch eine Kaufkraft von knapp 2.900 Euro. Das ist nun das Kapital, das der Staat zur Verfügung gestellt hat, um die Rentenlücke im Alter zu schließen.
Und was macht nun der ehemals Achtzehn-, inzwischen aber Siebenundsechzigjährige mit seinem Geld? Er macht genau das, was er soll: Er verwendet es, um sich eine zusätzliche Rente zu gönnen, indem er sich jährlich eine bestimmte Summe auszahlt, und zwar so bemessen, dass das Kapital für den Rest seines Lebens ausreicht. Das ist insofern etwas schwierig, als er nicht weiß, wie lange er noch zu leben hat, und auf Durchschnittsgrößen zurückgreifen muss. Ein 2020 geborener Mann hat eine statistische Lebenserwartung von 78,5 Jahren. Ich gönne meinem Kandidaten eine etwas längere Zeit, das er ja schon 67 Jahre lang überlebt hat und beispielsweise nicht als Kleinkind gestorben ist, und gehe davon aus, dass er sich auch am neunundsiebzigsten Geburtstag seine Privatrente für das nächste Jahr auszahlt und dann, am achtzigsten, nichts mehr da ist. Das sind 13 Zahlungen. Ich werde mich hüten, hier die Formeln aufzuschreiben, die man zur Berechnung der Rente braucht, sondern schlicht mitteilen, dass er beispielsweise bei einer unterstellten Verzinsung in Höhe von jährlichen 6% auf eine auszahlbare Jahresrente von 3.974 Euro und damit auf eine Monatsrente von 331 Euro kommt. Das klingt, zusätzlich zur gesetzlichen Rente, gar nicht schlecht, aber rechnet man wieder die Inflation ab 2038 ein, reduziert sich die Begeisterung ein wenig, denn die Kaufkraft dieser monatlichen 331 Euro entspricht im ersten Jahr der Auszahlung einer Kaufkraft von 125 Euro im Jahr 2038 und sinkt dann bis zum letzten Auszahlungsjahr auf gerade einmal 99 Euro. Man darf nicht vergessen, dass auch in den Jahren der Auszahlung die Inflation gnadenlos am Kapital nagt.
In der folgenden Tabelle habe ich die Monatsrenten, abhängig vom erreichten Zinssatz und vom Geschlecht aufgelistet. Warum vom Geschlecht? Im Durchschnitt leben Frauen länger als Männer, und da somit das Kapital auch länger vorhalten muss, sind die monatlichen Auszahlungen geringer. Das ist kein „gender pay gap“, sondern nur eine Folge weiblicher Längerlebigkeit, die ich so berücksichtigt habe, dass die letzte Auszahlung im weiblichen Fall am vierundachtzigsten Geburtstag erfolgt.
| Geschlecht | Monatsrenten in Euro | ||||
| Zinssätze | 3% | 4% | 5% | 6% | |
| männlich | Monatsrente | 57 | 103 | 185 | 331 |
| inflationsbereinigt | 22 – 17 | 39 – 31 | 70 – 55 | 125 – 99 | |
| weiblich | Monatsrente | 44 | 81 | 149 | 271 |
| inflationsbereinigt | 17 – 12 | 31 – 22 | 56 – 40 | 103 – 73 | |
Man kann es ablesen: Bei einer angenommenen Verzinsung von jährlichen 4% können sich Frauen zwar Monat für Monat 81 Euro auszahlen lassen, die aber im ersten Jahr der Auszahlung bezogen auf 2038 nur noch 31 Euro wert sind, im letzten sogar nur 22: die Inflation schläft nicht.
Den Effekt, dass die konstante Rente von Jahr zu Jahr an Wert verliert, kann man ausgleichen, indem man die Auszahlung dynamisiert, das heißt: sie jedes Jahr um die angenommene Inflationsrate von 2% wachsen lässt, womit der Wertverfall ausgeglichen wird. Das macht die Resultate nicht angenehmer, nur etwas realistischer. Ich beschränke mich in der nachstehenden Tabelle darauf, die inflationsbereinigten Monatsrenten anzugeben, wieder abhängig von Zinssatz und Geschlecht.
| Geschlecht | Inflationsbereinigte Monatsrenten in Euro | ||||
| Zinssätze | 3% | 4% | 5% | 6% | |
| männlich | Monatsrente | 19 | 35 | 63 | 113 |
| weiblich | Monatsrente | 14 | 26 | 49 | 89 |
Überwältigend ist das nicht. Es stimmt: Bei einer sehr optimistischen Zinsprognose ergeben sich immerhin 113 bzw. 89 Euro monatlich. Aber hier hat der Staat seine Finger im Spiel, und die Erfahrungen mit der Gesetzlichen Rentenversicherung und der Riester-Rente legen den Verdacht nahe, dass man sich eher im Bereich zwischen 3% und 4% bewegen dürfte mit inflationsbereinigten Monatsrenten zwischen 14 und 35 Euro. Die Rentenlücke, die damit geschlossen wird, muss klein sein. Ich möchte anmerken, dass ich jeweils auf 2038 zurückgerechnet habe, also auf den Zeitpunkt, zu dem die ersten Kandidaten 18 Jahre alt werden. Rechnet man auf die Kaufkraft des Jahres 2026 zurück, in dem die Aktion starten soll, sind die Ergebnisse noch etwas deprimierender.
Der staatliche Anteil der Frühstart-Rente führt also keineswegs dazu, dass etwaige Rentenlücken geschlossen werden können. Natürlich könnte der Volljährige des Jahres 2028 auch ohne die staatliche Beihilfe damit beginnen, für seine alten Tage vorzusorgen, und ohne Frage wird das bei etlichen auch geschehen. Nur braucht er dazu das staatliche Almosen nicht, das auf dem alten Prinzip beruht, erst die Bürger auszuplündern und ihnen dann einen kleinen Teil des Plünderungsgutes zurück zu geben. Das ginge einfacher, indem man den Leuten gleich weniger abnimmt: Reduzierung der Steuern, Reduzierung der Abgaben, sodass mehr in den Taschen des Einzelnen bleibt und er selbst frei entscheiden kann, wie er später einmal seine Rente aufbessern will. Je weniger der Staat für seine oft genug sinnfreie Politik den Menschen abverlangt, desto freier kann der einzelne Bürger agieren. Aber das mögen sie nicht, die Weltverbesserer und Freunde des bevormundenden Staates. Nichts behagt ihnen weniger als freie Bürger, die nicht vom Staat – und damit von seinen Vertretern nicht unbedingt bester Qualifikation – abhängig sind und ihre eigenen Entscheidungen treffen.
„Die Feinde der Freiheit haben ihre Verteidiger stets umstürzlerischer Absichten bezichtigt. Und fast immer ist es ihnen geglückt, die Arglosen und Wohlmeinenden zu überreden“, schrieb vor mehr als 80 Jahren der Philosoph Karl Raimund Popper. So war es damals, und so ist es noch heute. Auch bei scheinbar unbedeutenden Aktivitäten wie der Frühstart-Rente ist stets Vorsicht geboten, denn das Ziel freiheitsfeindlicher Politik besteht nur selten im Wohlergehen der Bürger, sondern darin, sie in staatlicher Abhängigkeit zu halten.
„Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes“: „Was immer es sei, ich fürchte die Danaer, auch wenn sie Geschenke bringen“, heißt es in Vergils Aeneis, bezogen auf das berühmte trojanische Pferd. Das kann man modernisieren: Ich fürchte die Politiker, auch wenn sie Geschenke bringen.
Denn die Geschenke der Politik haben wir alle vorher bezahlt.
Merz taumelt ins Kanzleramt – aber um welchen Preis? Das wahre Drama hinter dem zweiten Wahlgang
Geheim-Urteil gegen die AfD: Der Staat brandmarkt – aber die Begründung dafür verrät er uns nicht
CDU unterschreibt ihr Ende – Koalitionsvertrag macht sie endgültig zu rot-grünem Erfüllungsgehilfen
Thomas Rießinger ist promovierter Mathematiker und war Professor für Mathematik und Informatik an der Fachhochschule Frankfurt am Main. Neben einigen Fachbüchern über Mathematik hat er auch Aufsätze zur Philosophie und Geschichte sowie ein Buch zur Unterhaltungsmathematik publiziert.
Bild: Shutterstock
Bitte beachten Sie die aktualisierten Kommentar-Regeln – nachzulesen hier. Insbesondere bitte ich darum, sachlich und zum jeweiligen Thema zu schreiben, und die Kommentarfunktion nicht für Pöbeleien gegen die Kommentar-Regeln zu missbrauchen. Solche Kommentare müssen wir leider löschen – um die Kommentarfunktion für die 99,9 Prozent konstruktiven Kommentatoren offen zu halten.
Mehr von Thomas Rießinger auf reitschuster.de

AfD-Gutachten: Ein Meisterstück staatlich gelenkter Deutungskunst
Wer „Great Reset“ sagt, meint Juden. Wer widerspricht, bestätigt es. Wer schweigt, sowieso. Thomas Rießinger hat sich durch das AfD-Gutachten gearbeitet. Hier seine Ergebnisse.

„Die Bibel queer gelesen. Wieso G*tt Fan von Vielfalt ist“
Trost in schweren Zeiten war gestern. Heute sind es Workshops wie „Queer in der Klimakrise“ und Bibelarbeit mit Katrin Göring-Eckardt. Die Folge: Jahr für Jahr verliert die Kirche Hunderttausende Mitglieder. Von Thomas Rießinger.

Skurrile Stellenanzeige: Angestellte für bezahlten Unsinn gesucht
Karlsruhe sucht Haltung statt Kompetenz: Wer mit queerfeministischer Gesinnung und Gender-Floskel-Sicherheit glänzt, bekommt ein gut dotiertes Plätzchen in der Stadtverwaltung – mitten in der Haushaltssperre. Von Thomas Rießinger.

10-Punkte-Plan zur geistigen Entmündigung der Bevölkerung
Ein harmlos wirkender Auftrag an ChatGPT endet mit einer Diagnose über Deutschlands geistige Verfassung. Zehn Punkte, nüchtern präsentiert – und überraschend frei von ideologischer Tarnung. Von Thomas Rießinger.

Schwarz-Rot regiert am Volk vorbei. In die Sackgasse.
Polit-Erziehung durch Preise, Meinungskontrolle per Gesetz – und dazu ein Kinderlied als Spiegel. Wer noch Hoffnung hatte, wird enttäuscht: Der Merkel-Kurs wird konsequent fortgesetzt. Von Thomas Rießinger.

Der Mann im Knast, der uns befreit
Ein Gefangener, der wegen falscher Worte im Bau sitzt – und ein Publikum, das den Sketch für einen Skandal hält: Hallervorden bringt auf den Punkt, wie tief Satire heute gesunken ist. Doch die Reaktionen zeigen: Es war höchste Zeit.

Aggressive Attacke auf Autofahrer – nach Unfall mit Kind
Ein Kind wird angefahren, kurz darauf versammelt sich eine aggressive Menge, beschädigt das Auto, verletzt einen Beifahrer. Zur Identität der Angreifer kein Wort. Von Thomas Rießinger.